Autor Uwe Timm über München: "Schauen Sie mal die Hunde an!"
München - AZ-Interview mit Uwe Timm: Er wurde 1940 in Hamburg geboren. Einer seiner größten Erfolge war "Die Entdeckung der Currywurst".
AZ: Herr Timm, Sie sind 1963 als junger Norddeutscher zum Studieren nach München gekommen. Wie roch die Stadt?
UWE TIMM: Es roch nach Pferdepisse, anders als in Hamburg. Denn hier wurden die Bierfässer noch von Pferdegespannen durch die Straßen gefahren.
Was war das Bild, das Sie von München gehabt hatten?
Ich wollte immer nach München. Ich hatte die Vorstellung, dass das eine südliche Stadt ist. Mich interessierte die Antike, ich wusste, dass das hier das Isar-Athen ist und mochte das Barocke.
Wurden Sie enttäuscht?
Nein. Ich staune immer noch jedes Mal, wenn ich über den Odeonsplatz gehe. So etwas wie die Theatinerkirche – das gibt es in Hamburg mit seiner dunklen Backstein-Gotik nicht.
Was war Ihre allererste Begegnung in der Stadt?
Ich hatte großes Glück. Ich nahm mir ein Taxi zu einer Pension in der Kaulbachstraße – und der Fahrer war ein leidenschaftlicher München-Kenner. Er hat mir, vermutlich mit einigen Umwegen, die Stadt gezeigt.
Als in München Ex-Wehrmachtsoffiziere als Polizisten unterwegs waren
Ihr erster Eindruck am ersten Tag?
Die Stadt hat sich mir gleich weit geöffnet, man fuhr noch über den Marienplatz. Es war ein warmer April-Tag, an den Brunnen saßen junge Menschen, machten Musik, eine fantastische Stimmung.
Ihr erstes richtiges eigenes Zimmer war in der Viktoriastraße in Schwabing. War die Stimmung im Viertel ein Jahr nach den Schwabinger Krawallen noch geprägt von den Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten und Polizei?
Ja, das war unter den Studenten noch ein großes Thema. Viele hatten das miterlebt, man sprach mit Zorn darüber.
Also war Schwabing 1963, fünf Jahre vor 68, schon jugendlich-rebellisch?
Nein, nicht besonders. Diese Unruhen 1962 waren ja letztlich vor allem das Ergebnis einer sehr autoritär verfassten Exekutive gewesen. Da waren Polizeioffiziere unterwegs, die Wehrmachtsoffiziere gewesen waren und mal ordentlich draufhauen wollten.
Wie war Schwabing dann, wenn noch nicht ernsthaft rebellisch?
Es war sehr freundlich und ruhig, beinahe dörflich.
Das Dörfliche: Woran erinnern Sie sich da?
An der Uni gab es zum Beispiel noch einen Milchladen. Da ging man hin und kaufte eine Semmel und ein Glas Milch. Mit dem Friseur hatte ich Verständigungsprobleme. Das Bairische war im Alltag noch auf eine ganz andere Weise präsent.
Wie war es im Alltag als Norddeutscher? Spürten Sie Ressentiments?
Männer wurden manchmal unfreundlich zu mir. Da ich das nasale Hamburgerisch spreche, wurde mir Arroganz unterstellt. Auch bei Vermietungen war es als Norddeutscher nicht einfach. Es gab einfach eine gewisse Distanz zu Preußen.
Sie erzählen das so fröhlich.
Ich bin ein zugewandter, neugieriger Mensch. Ich bin dann schon mit den Leuten ins Gespräch gekommen.
"Man sah weiße Kutten, Büßer-Kutten"
Was fiel Ihnen noch auf an den Bayern, den Münchnern?
In meiner Erinnerung sind die Straßen bei Weitem nicht so überlaufen wie heute. Und es waren sehr viele Priester, Mönche, Nonnen unterwegs. Man sah weiße Kutten, Büßer-Kutten. Das war richtig präsent im Stadtbild.
Gab es damals in Hamburg schon Eiscafés?
Ein einziges Restaurant gab es, wo man draußen sitzen konnte: den Alsterpavillon. Das war schon ein Riesen-Unterschied. In München stellten ganz viele Cafés ihre Tische raus, besonders natürlich an der Leopoldstraße. Man kam viel leichter ins Gespräch. In Hamburg war es undenkbar, dass man sich an einen Tisch dazusetzte.
1966 gingen Sie für ein Jahr nach Paris. Sie haben mal geschrieben, 1967 seien Sie in eine andere Stadt zurückgekehrt. Inwiefern?
Ich war auch davor schon beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS gewesen, da saßen 1966 vielleicht 20 Hanseln in einem Keller. Als ich zurückkam, war der rappelvoll. Nach dem Mord an Benno Ohnesorg war die Situation eine völlig andere, alle redeten über die politische Praxis, die Hochschulrechte, über Gesetze, Psychiatrie, die Dritte Welt.
Eine plötzlich total politisierte Stadt?
Na ja, natürlich in einem bestimmten akademischen Kreis – und auch da haben sich zum Beispiel die Betriebswirte wenig beteiligt. Wenn wir da in eine Vorlesung im Audimax mit 700 Studenten kamen, weil wir über einen Streik sprechen wollte, kam es aus 700 Mäulern: "Raus!"
Wie nahmen Sie die Kultur-Szene wahr?
Als sehr stark. Wir machten selbst die Literarischen Hefte, es gab die Filmer, Werner Herzog, Wim Wenders, Reinhard Hauff, Schlöndorff, das Antitheater von Fassbinder und so weiter.
"Reichen-Ghettos? Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen"
Sie haben der AZ mal erzählt, dass Sie, als Sie in den 70ern hier ins Lehel gezogen seien, von allen Balkonen im Hof politische Diskussionen gehört hätten. Wann hat sich das wieder geändert – und wieso?
Das war damals wirklich so. Wenn man high werden wollte, reichte es, auf den Balkon zu gehen, da musste man gar nicht selbst kiffen. Wilde Diskussionen. Schauspielerinnen wohnten da, junge Regisseure. 1981 gingen wir nach Rom, danach lebten wir einige Jahre am Ammersee, Anfang der Neunziger war dieses Gefühl dann auf jeden Fall weg. Heute finde ich die Gespräche, die ich vom Balkon höre, banal. Es geht nicht mehr um Politisches – oder die Emanzipation in der Beziehung.
Wenn Sie sich an das Lehel um 1980 erinnern – war es noch geprägt von den Meister-Eder-artigen Werkstätten in den Hinterhöfen?
Unten im Haus war noch ein Tischler, darüber lebte eine Frau, die eine Holzhandlung hatte. Die erzählte immer, dass ihr Mann noch aus dem Krieg zurückkäme. Wohlgemerkt aus dem Ersten, nicht aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute haben noch mit Kohlen geheizt, ein Haus weiter gab es auch noch eine Hinterhof-Werkstatt.
Erkennen Sie im heutigen Lehel noch irgendwelche Reste des alten Flairs?
Paradiso, der Grieche da vorne, hat die Ecke wiederbelebt. Der Bäcker an der Ecke. Der kleine Blumenladen. Und es gibt immer noch viele nette und interessante Menschen hier. Aber insgesamt ist die Entwicklung eher negativ. Schauen Sie nur mal die Hunde an, das sind Jagdhunde, die so edel aussehen.
Welche Hunde gab es früher im Lehel?
Mischlinge, Zamperl, man sah Rentner damit herumlaufen. An den Hunden sieht man, was mit einem Viertel los ist.
Und woran noch?
An den Autos. Schauen Sie die ganzen Porsche und SUVs, die hier rumfahren. Und: Wir sehen weiße, teure Neubau-Blocks, in denen noch nach Jahren etwas leersteht. Das wird offenbar gekauft und dann nicht mal genutzt.
Kann man im Lehel beobachten, was vielen Münchner Vierteln noch bevorsteht: das Entstehen von Reichen-Ghettos mit immer weniger Leben?
Die Tendenz ist klar, man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Aber natürlich gibt es auch noch Hausbesitzer, die soziale Verantwortung haben, das höre ich schon auch, es nehmen ja nicht alle die Höchstmieten.
Die Menschen haben den ungenutzten Freiraum erkannt
Was hat das Corona-Jahr verändert, hier, in Ihrem Umfeld?
Ich laufe jeden Tag durch den Englischen Garten. Und plötzlich sind die Wiesen voll mit Tausenden von Menschen auch mit Migrationshintergrund aus weiter entfernten Bezirken.
Wie erklären Sie sich das?
Die Leute haben diesen Freiraum, wo sie vorher offenbar nie waren, erkannt, geradezu besetzt. Das finde ich sehr interessant und gut. Es hat aber auch Schattenseiten.
Welche?
Ich sehe schweren Alkoholismus, betrunkene 14-jährige Mädchen, ich staune über die Müllberge, die man am frühen Morgen noch sehen kann.
Es gibt dort für Münchner Verhältnisse erhebliche Konflikte mit der Polizei. Erkennen Sie Parallelen zu den 60er Jahren?
Nein.
Aber das ist doch wieder Jugend in Auseinandersetzung mit staatlicher Autorität!
So gesehen haben Sie schon recht. Und es werden eben auch wieder Freiräume gesucht. Aber dieser unheimliche Alkoholkonsum, diese massenhafte Besoffenheit – so war 68 nicht.
So ist es heute doch auch nicht überall.
Ich habe mir auch die Situation an der Türkenstraße angesehen. Das ist schon eher mit den Sechzigern vergleichbar, das ist doch ein überwiegend junges Publikum, das nach Corona eben wieder rausdrängt und feiert. Eine gute Stimmung.
"Diese ganzen Klamottenläden gehen mir auf den Keks"
Sie haben eine Wohnung in Berlin. Wann geht Ihnen München so auf den Geist, dass Sie sagen: Jetzt muss ich nach Berlin?
Ich kann nicht sagen, dass ich fliehe. Ich habe Familie in Berlin, oft Termine dort. Ich habe dort eine stille Wohnung, in der ich gut arbeiten kann. Aber mein Lebensmittelpunkt ist hier.
Was unterscheidet Berlin von München?
In Berlin ist ständig was los, auch ständig etwas Spannendes. Hier wird man in Ruhe gelassen, das mag ich.
Was muss München von Berlin lernen?
Es gehen zu viele junge Leute aus München weg. Man müsste es zum Beispiel hinbekommen, dass die Stadt Häuser aufkauft und jungen Literaten und Künstlern zur Verfügung stellt.
Der Markt wird es nicht regeln.
Im Gegenteil. Der Markt vertreibt die Leute von hier.
Wenn Sie heute durch Schwabing gehen: Was denken Sie?
Es gibt fast überhaupt keine Antiquariate mehr, kaum noch Buchläden. Die ganzen Klamottengeschäfte gehen mir auf den Keks. Und diese spezielle Gastronomie: Burger mit Thymian, alles muss so apart sein, alles exquisit.
Timm über die Kulturszene: "1990 ist der Bruch gewesen"
Wenn Sie heute ein junger Mann in Norddeutschland wären: Würden Sie statt nach München nach Berlin gehen – oder gleich nach Rom?
Ja, wahrscheinlich würde ich nach Berlin gehen. Aber damals war München kulturell wirklich sehr interessant, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Literatur hat eine ganz andere Rolle im städtischen Leben gespielt als heute, man konnte in Kneipen lesen und es fanden sich immer 20, 30 Leute, die das interessiert hat. Die Jazz-Szene, die Film-Leute, Happenings, irgendwer hat dann noch irgendwo ein Klavier zertrümmert.
Was war der Wendepunkt für München, kulturell?
1990 ist der Bruch gewesen. Ich hätte damals nicht geglaubt, dass die kulturelle Szene so abstürzt, Berlin ist wirklich zu einem Staubsauger für junge Menschen geworden.
Sie haben mal gesagt, Hamburg-München-Vergleiche nerven Sie. Machen Sie eine Ausnahme für uns: Wo ist München für Sie einfach immer noch die bessere Stadt?
Das fängt mit dem Klima an. Und ich mag die Architektur, dass sich hier so viel draußen abspielt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man durch München schlendert, das ist in Berlin und Hamburg anders. Ich mag den Münchner Dialekt und die Freundlichkeit.
Haben Sie mal gedacht: Mir reicht es mit meinem Lehel, ich ziehe an den Stadtrand, wo noch mehr normale Leute wohnen?
Nein, nie. Es ist schon nach wie vor sehr schön hier. Ich fühle mich hier zu Hause.
- Themen:
- München






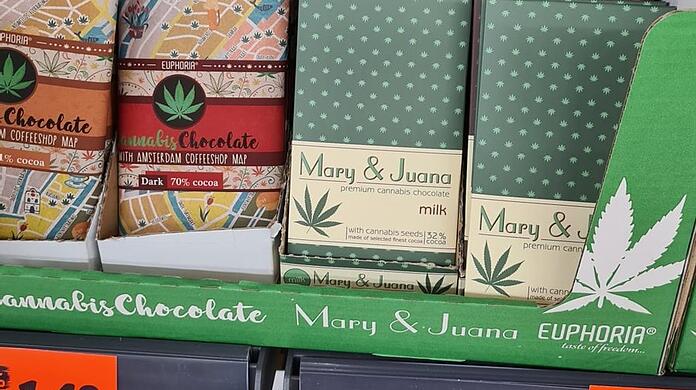






 Schöne Grüße übrigens....do you remember?
Schöne Grüße übrigens....do you remember?