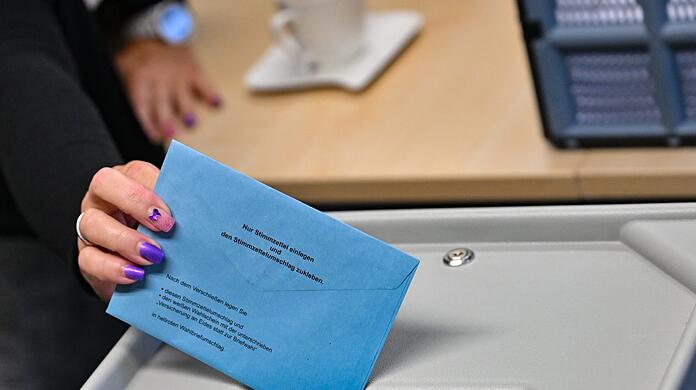Klimaschädliche Heizungen: Politiker scheitern am Einbau von Wärmepumpen und Solaranlagen
Berlin - Der Vorgang löste in Berlin einigen Hohn und Spott aus. Die Grünen – ausgerechnet die Grünen, muss es wohl heißen – wollen in ihrer Parteizentrale eine Wärmepumpe einbauen und bekommen es nicht hin. Seit mehr als drei Jahren geht das nun schon so.
Schuld sind die baulichen Gegebenheiten. Die neben der Charité gelegene Bundesgeschäftsstelle ist in einem Altbau untergebracht, eine Wärmepumpe lässt sich da nicht eben mal so installieren. Für den geplanten Betrieb mit Erdwärme muss ein tiefes Loch gebohrt werden, in einer Großstadt mit weit in die Tiefe reichenden U-Bahn-Tunneln, Kabelschächten und Abwasserkanälen ist das keine Lappalie.
Grüne wollen Wärmepumpe in der Parteizentrale in Berlin installieren
Ein Parteisprecher gab auf AZ-Anfrage jetzt aber Entwarnung. Im Herbst soll die Wärmepumpe in Betrieb gehen und die Parteizentrale im Winter so erwärmen, wie es das Gebäudeenergiegesetz vorschreibt. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass die Grünen mit der Wärmepumpenplanung begannen, bevor sie an die Regierung kamen.
Im Grunde genommen waren die Ökos ihrer Zeit und ihrem Wirtschaftsminister Robert Habeck also ein Stück voraus. Würden sie sich an die Empfehlungen des neuen Heizungsgesetzes halten, wäre die Wahl womöglich gar nicht auf eine Wärmepumpe gefallen. Habecks Haus rät insbesondere in alten und denkmalgeschützten Gebäuden zum Heizen mit Holz, Hackschnitzel oder Pellets.
Im Bundeskanzleramt wird noch mit Öl geheizt
Zur aufgeregten Debatte taugt eher das Kanzleramt. Wie der 2001 fertiggestellte Bau denn beheizt werde, wollten die Linken im Bundestag wissen. Die ernüchternde Antwort im besten Beamtendeutsch: "Der Bedarf an Wärmeenergie für das Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1 in Berlin, wird derzeit über eine Heizungsanlage auf Basis des Primärenergieträgers Heizöl gedeckt."
Man kann nur spekulieren, warum die Planer damals nicht wenigstens auf eine Gasheizung setzten. Im September nächsten Jahres erst wird das Kanzleramt den Planungen zufolge ans städtische Fernwärmenetz angeschlossen. Immerhin: Der wohl milliardenschwere Erweiterungsbau soll zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energieträgern versorgt werden. Wenn er denn irgendwann mal fertig wird.
Erneuerbare Energien sind in den Regierungseinrichtungen noch ein Fremdwort
Das Reichstagsgebäude gleicht mit seinem Energiekonzept hingegen eher einem Kreuzfahrtschiff. Zwölf-Zylinder-Dieselmotoren mit jeweils rund 540 PS sorgen einerseits für Strom, der auch die anderen Liegenschaften des Bundestages versorgt. Die Motorwärme wiederum wird zum Heizen genutzt, ergänzt durch vier Heißwasserkessel. Betrieben wird das alles mit Biodiesel (Rapsmethylester).
Die Bundesministerien verwenden bereits Fernwärme. Der Berliner Betreiber des Fernwärmenetzes wiederum nutzt für die Erzeugung zu drei Vierteln Erdgas und zu 16,5 Prozent Steinkohle – dem GEG-Gedanken folgt das nicht. Es gibt Ausnahmen. Der Bonner Dienstsitz von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird mit Fernwärme von den Stadtwerken versorgt, die ihre Wärme etwa je zur Hälfte aus einer Müllverbrennungsanlage und aus Erdgas holen. Photovoltaik und Solarthermie hingegen sind Fremdworte im Verteidigungsministerium.
Dabei werden die Ministerien bei ihren Bemühungen, im Gebäudesektor möglichst viel Energie einzusparen, von ähnlichen Sorgen und Nöten ausgebremst wie normale Häuslebauer. Im Verkehrsministerium von Volker Wissing (FDP) heißt es beispielsweise: "Die Dach- beziehungsweise Fassadenflächen des Dienstgebäudes in Berlin sind aus statischen, architektonischen und denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht vollumfänglich für Photovoltaik beziehungsweise Solarthermie geeignet." Manchmal ist eben ein Wille da, aber kein Weg.
- Themen:
- Bundeskanzleramt
- Deutscher Bundestag
- FDP
- Politik
- SPD