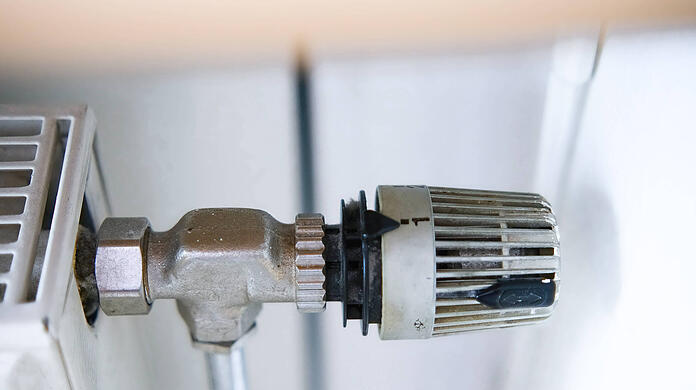Zu wenig Solar auch in München: Grüne steigen Söder aufs Dach
München - Die Zielmarke ist klar: Bis 2030 will die Bayerische Staatsregierung die Produktion von Erneuerbaren Energien verdoppeln, Photovoltaik sogar verdreifachen. "Jedes Fitzelchen" an Erneuerbaren Energien solle genutzt werden, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gesagt, als er diese Strategie vorgestellt hat. Bisher geschehen ist aber: eher wenig. Das gilt auch für die Landeshauptstadt.
131 Gebäude für Photovoltaik-Anlagen geeignet – 61 Gebäude ausgestattet
Nicht einmal die Hälfte der als geeignet eingestuften staatlichen Liegenschaften in München hat bisher eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das zeigt eine Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen, die der AZ exklusiv vorliegt. In München sind demnach laut Bauministerium 131 bauliche Anlagen, wie es im Behördensprech heißt, für eine Installation geeignet – nur 61 davon sind mit den Solarmodulen ausgestattet.
Siekmann: "Die Energiewende in Bayern wird von den Bürgern umgesetzt"
"Beim Ausbau der Photovoltaik auf den eigenen Dächern kommt die Söder-Regierung nur im Schneckentempo voran", sagt der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Florian Siekmann der AZ.

In München verschenke die Staatsregierung leichtsinnig Potenzial. "Es zeigt sich einmal mehr, die Energiewende in Bayern wird von den Bürgern umgesetzt, nicht von der Söder-Regierung."
Unter anderem LMU-Gebäude und Klinikum rechts der Isar ohne Photovoltaik
Kritisch sehen das die Grünen auch deshalb, weil unter den staatlichen Liegenschaften in München, die bisher noch kein Photovoltaik haben, viele mit einem hohen Energieverbrauch sind. Dazu zählen der Antwort zufolge Gebäude des LMU-Klinikums München und des Klinikums rechts der Isar, ebenso mehrere Gebäude der Fakultät für Chemie und Pharmazie der LMU. Siekmann beklagt, Söder und seine Regierung könnten nicht "ununterbrochen über die Energieentlastungen des Bundes jammern", wenn sie gleichzeitig jahrelang versäumt habe, im eigenen Land die Energiekosten zu senken.
"Planung und Investitionskosten muss der Freistaat übernehmen"
Er fordert eine umgehende Ausstattung energieintensiver Gebäude mit Solarmodulen. "Planung und Investitionskosten dürfen nicht auf die Einrichtungen abgewälzt werden, sondern müssen vom Freistaat übernommen werden."
Bereits im April 2022 hatten die Grünen den auch bayernweit ihrer Ansicht nach zu langsamen Ausbau von Photovoltaikanlagen auf staatlichen Dächern kritisiert. Damals warf Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann dem Freistaat vor, von rund 11.000 Dächern staatlicher Gebäude seien gerade einmal 3,7 Prozent mit solchen Anlagen belegt.
Grüne: 1.300 geeignete Gebäude viel zu wenig
Bauminister Christian Bernreiter (CSU) konterte: Nur etwas mehr als zehn Prozent der staatlichen Dächer, also gerade einmal 1.300, seien überhaupt für Photovoltaik geeignet. Davon seien auf 400 bereits Anlagen installiert, weitere 100 befänden sich in der Planung oder im Bau – ein Anteil von 40 Prozent. Nach Ansicht der Grünen ist die Zahl von 1.300 Dächern zu niedrig angesetzt.
Ausschreibung für private Investoren endet am 23. Januar
Untätig ist die Staatsregierung seitdem nicht gewesen: Im November verkündete Bernreiter, man habe 66 Photovoltaik-Flächen auf staatlichen Dächern zur Verpachtung für private Investoren ausgeschrieben – auch, weil der Investitionsbedarf für den Ausbau sehr hoch ist. Konkret handelt es sich um 31 Dachflächen in Schwaben und 35 in Oberbayern.
Die Angebotsfrist endet am 23. Januar dieses Jahres. Außerdem stelle die Staatsregierung 125 Millionen Euro zur Errichtung weiterer Anlagen zur Verfügung.
Zu Spitzenzeiten werden in Bayern bis zu 12,7 Gigawatt verbraucht
Derzeit ist Bayern noch in hohem Maße auf Stromimporte angewiesen und wird das nach Einschätzung der Energiewirtschaft vorerst auch bleiben. Zu Jahresbeginn prognostizierte der Stromerzeugerverbands VBEW dem Freistaat einen Rückgang der gesicherten Stromerzeugungsleistung auf 9,2 Gigawatt – sofern das AKW Isar 2 am 15. April vom Netz geht.
Zu Spitzenzeiten würden in Bayern aber bis zu 12,7 Gigawatt verbraucht. Jedoch setzte der Verband die Leistung von Wind- und Solarenergie mit null an.