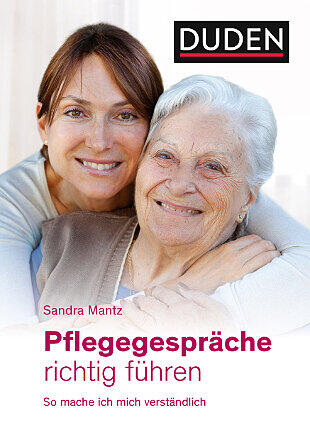Sandra Mantz: Diese Generation hat sich durchgebissen
München - Die gelernte Altenpflegerin Sandra Mantz ist Sprachkompetenztrainerin und leitet die Sprachgut-Akademie im Odenwald. Mit der AZ spricht sie über ihre Erfahrungen und ihr Buch "Pflegegespräche richtig führen".

AZ: Frau Mantz, Ihr Buch heißt "Pflegegespräche richtig führen". Was kann man denn dabei falsch machen?
SANDRA MANTZ: Falsch machen können Sie eigentlich nur etwas auf der emotionalen Ebene – indem man aneinander vorbeiredet, indem Menschen Dinge sagen, die sie anders meinen, indem Menschen Dinge hören, die gesagt wurden, aber die durch die eigene Gedankenwelt anders gedeutet werden.
Sie sind Sprachkompetenztrainerin. Welchen Bezug haben Sie zur Pflege?
Ich habe über 25 Jahre selbst gepflegt, insbesondere hochbetagte und sterbende Menschen. Damals habe ich gelernt, dass eine gute Kommunikation extrem wertvoll ist.
Eine zentrale These Ihres Buches ist es, Pflegebedürftige weiter als Menschen zu sehen und anzuerkennen. Das ist doch selbstverständlich, oder?
Die Gesellschaft hat sehr viel Angst vor Pflegebedürftigkeit und der einzelne Mensch natürlich auch, weil Abhängigkeiten und Kontrollverlust entstehen. Tatsächlich haben ganz viele Menschen Angst, dass sie dann nicht mehr die Frau Schmidt sind, sondern eben "die mit der Demenz", die nicht mehr richtig "funktioniert". Die Sorge ist, dass man dadurch ein Stück Grundrespekt verliert.
In der Pflege ist es wichtig, rechtzeitig über Eventualitäten zu sprechen
Gibt es Faustregeln, wie man über Pflegebedürftigkeit sprechen sollte?
Extrem hilfreich ist es, wenn man rechtzeitig über Eventualitäten spricht. Je eher ich darüber spreche, umso mehr Beruhigung und Rationalität kann reinkommen, weil ich mich dann auf etwas berufen kann.
In den meisten Familien ist das wohl eher kein Thema für den Kaffeeklatsch. Wie leite ich ein solches Gespräch denn ein?
Schön ist natürlich, wenn die Eltern die Kinder ansprechen. Aber wenn die Eltern das nicht tun, sollten sich zum Beispiel Geschwister zusammentun. Dan kann man gemeinsam überlegen: Wie schätzen wir Mama und Papa ein? Wenn man das Gefühl hat, das geht gar nicht, dann würde ich mich im Umfeld umschauen. Gibt es zum Beispiel einen Hausarzt des Vertrauens, den man darauf ansprechen kann? Oder gibt es Nachbarn oder Freunde, zu denen die Personen eine engere Bindung hatten?
Wie spreche ich zum Beispiel meine Mutter darauf an, dass sie Hilfe braucht, ohne sie vor den Kopf zu stoßen?
Die jetzige Generation ist eine, die sich durchgebissen und keine Hilfe angenommen hat. Deshalb würde ich das immer erst einmal würdigen. Dann kann man weitermachen: "An der ein oder anderen Stelle würde es dir guttun, Hilfe zu bekommen. Und wann immer du dazu bereit bist, bin ich sofort da und helfe dir. Wenn du die Hilfe jedoch ablehnst, musst du damit rechnen, dass ich vielleicht auch Grenzen habe, dir dabei tatenlos zuzuschauen."
Gespräche über Pflege: "Je länger man wartet, desto schwieriger wird es"
Wie sage ich jemandem, dass ich ihn nicht pflegen will?
Wenn es nicht geht, dann muss man das offen ansprechen – aber man muss auch die Erwiderung ertragen. Man könnte zum Beispiel sagen: "Mama, Papa, ich habe mir das lange überlegt und es ist mir so wichtig, aber ich schaffe es zeitlich nicht" – oder finanziell, oder aufgrund der Wohnungssituation. Hier gilt wieder: Je länger man wartet, desto schwieriger wird es.
Wenn man einen Pflegegrad beantragen möchte, gibt es eine Begutachtung des Pflegebedürftigen. Oftmals ist das dann genau der Tag, an dem dieser topfit ist. Wie sage ich als Angehöriger dem Gutachter, dass das nicht der realen Situation entspricht?
Viele bieten inzwischen an, dass eine Art Pflegetagebuch geführt wird, um zu skizzieren, dass es gute und schlechte Tage gibt. Viele Gutachter kennen diese Situation natürlich auch. Man kann aber auch im Vorfeld mit den Gutachtern sprechen und bitten, dass ein Teil mit dem Pflegebedürftigen besprochen wird und ein Teil ohne ihn oder sie. Oder man fragt, ob es möglich ist, den Gutachter im Nachhinein nochmal zu kontaktieren, um weitere Informationen zu geben.
"Gut ist es, sich vorzubereiten"
Was kann ich als Angehöriger einem Pflegedienst mit auf den Weg geben, damit sich der Pflegebedürftige so wohl wie möglich fühlt?
Man sollte viel von den liebgewonnen Lebensritualen erzählen. Das sind oft alltägliche Sachen: Kaffee mit oder ohne Milch? Ist jemand eher still oder war er gern in Gesellschaft, welchen Beruf hatte er? War er religiös? Das sind Kleinigkeiten, die aber extrem hilfreich sind für Pflegende, weil sie dadurch das Gesamtwohlbefinden des Pflegebedürftigen besser einschätzen können.
Als Angehöriger muss man viel mit Ärzten oder Pflegern kommunizieren – und ist schnell überfordert, wenn diese mit Fachvokabular um sich werfen. Was ist zu tun?
Gut ist es, sich vorzubereiten. Ich überlege mir also vorher, was der Sinn des Gesprächs ist und was hinten dabei rauskommen soll. Je klarer mir das ist, umso eher kann ich in so ein Gespräch einsteigen. Gut ist es, schon zu Beginn das Wichtigste sagen, etwa so: "Das, was mich am meisten beschäftigt, ist…" . Das sollte man am Anfang sagen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, wenn wenig Zeit ist, wenigstens das geklärt wird.
Sie haben sich intensiv mit dem Thema Pflegebedürftigkeit auseinandersetzt. Auch, wenn die Frage sehr persönlich ist: Wie möchten Sie selbst gepflegt werden?
Ich wünsche mir Menschen um mich herum, die ganz viel Humor haben und die es als natürlich empfinden, dass ein Leben auch vergänglich ist. Ich möchte mich bis zum Schluss umsorgt und umarmt wissen von Menschen, die das Leben lieben, aber mir auch die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wenn es für mich an der Zeit ist zu gehen.

Das Buch "Pflegegespräche richtig führen" von Sandra Mantz ist kürzlich im Duden- Verlag erschienen. 2019, 160 Seiten, Taschenbuch, zehn Euro.
Lesen Sie auch: Miet-Horror in München - Mit 75 fliegt sie aus ihrer Wohnung
- Themen: