"Der Untertan" von Heinrich Mann im Cuvilliéstheater

Er ist ein Jahrhundertroman, dieser „Untertan“ von Heinrich Mann - und das im doppelten Sinne: weil er fast das gesamte deutsche 19. Jahrhundert erhellt und weil er in seiner Mischung aus Realsatire, treffender Sprache, politischer und psychologischer Analyse schon beim Erscheinen als Fortsetzungsroman 1914 ein literarischer Geniestreich war.
Regisseur Alexander Eisenach hat sich für seine Dramatisierung am Cuvillìéstheater daher die Gretchenfrage stellen müssen: Wie hältst du es denn mit Werktreue und dem Bezug zu heute? Und nach kompakten, turbulenten und dynamischen zwei Stunden ist klar: Es ist große Theaterkunst entstanden. Eisenach hat eine brisante Aktualität herausgearbeitet, ohne dass er Heinrich Manns Roman-Vorlage nur als Steinbruch missbraucht hätte.
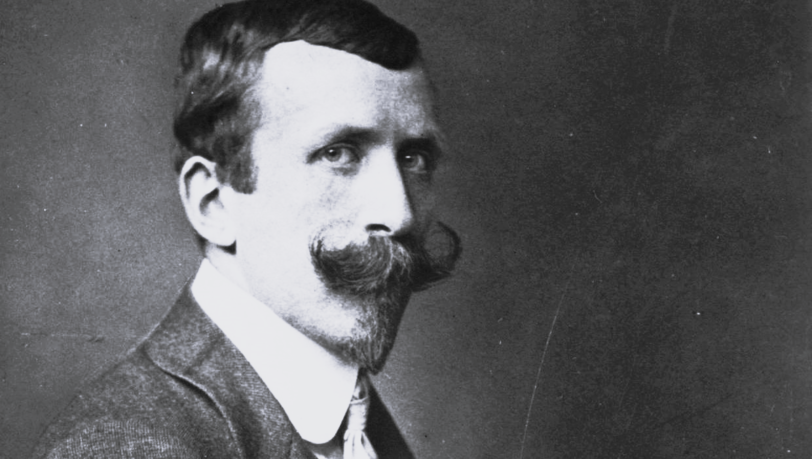
Aber wer einen Roman dramatisiert, muss einen neuen Text schreiben. Eisenach hat da einen packenden Stil und eine gelungene Form gefunden. Frei mischt er heutige Sprache ein, scheut auch Drastik nicht, übertreibt auch manchmal. Aber wer seinen Heinrich Mann liebt, wird viele Sätze wiedererkennen und inhaltlich alles: von der züchtigenden Autorität des Vaters und des Schulsystems, der Wurstverehrung Diederich Heßlings über burschenschaftliches Sauf-Brimborium bis zu den Sätzen des alten Buck, dem Honoratioren und Kämpfer für ein anderes, ein demokratisch-liberales Deutschland - das Gegenteil dessen, worauf Typen wie Diederich Heßling erfolgreich hinarbeiten. In Anbetracht der niedergeschossenen Arbeiterdemonstrationen und des neuen, nationalen, kapitalistischen Aufsteigertyps Diederich Heßling sagt der alte Buck auf dem Sterbebett: „Ich habe den Teufel gesehen“ und „Es war alles umsonst!“

Aber genau da setzen Roman und auch Eisenach beim Leser und Zuschauer mit einer Hoffnung an: mit einem „Nie wieder!“ Und dafür, dass dieser so berechtigte Wunsch nicht bleischwer, belehrend und selbstgerecht daherkommt, hat der satirische Charakter des Romans und jetzt Eisenach gesorgt mit viel sprachlich geistreichen und visuellem Witz.
Wenn sich Heßling am Ende an seiner eigenen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Denkmal-Enthüllungsrede so berauscht, ja aufgeilt, dass er fast einen Orgasmus bekommt, spielt Lukas Rüppel das als inhaltlich beklemmende, dabei aber auch als klamaukige Groteske - und das alles ohne Lächerlichkeit, sodass sich immer eine überzeugende Balance aus überbordendem Witz, Drastik und Ernst ergibt. Und das zeichnet die gesamte Inszenierung aus.

Das „weiche Kind, Deutschland“ an der Wegscheide
Ein Chor aus sechs Frauen - weiß gekleidet zwischen Bräuten, Dominas, Engeln und Walküren - zitiert gleich die berühmten Einstiegssätze, vom „weichen Kind“ Diedrich Heßling, das in seiner Empfindsamkeit formbar und „zurichtbar“ war. Womit auch angezeigt wird, dass in Diedels Sentimentalität, Furchtsamkeit und Mutterliebe auch die Chance bestanden hätte, dass sich alles ins Geistig-Künstlerische, Menschliche hätte entwickeln lassen, anstatt ins Brutale, Autoritäre abzugleiten. Und schon anfangs - und wieder am Ende des Stücks - in der Wiederholung machen die Frauen aus dem „weichen Kind“ auch ein „weiches Deutschland“, das an den Ohren litt, weil es nicht hören (und sehen) wollte, worauf alles hinausgehen wollte!
Autoritäre Erziehung, Männlichkeitswahn und Misogynie
Diederich, der neureiche Bürger mit seiner „mystischen“, masochistischen Verbindung zum Kaiser ist ein durch Erziehung, Männlichkeitswahn und Misogynie deformierter deutscher Typus und ist die Personifikation Deutschlands auf dem Weg in ungezügelten Kapitalismus und Autokratie.
Auf der drehbaren Bühne (Daniel Wollenzin) steht eine gotische Kirchenruine. Die kann man anfangs noch als romantische Reminiszenz an Caspar David Friedrich empfinden, dann wird sie - als Spiegel der Geschichte - zur Ruine der Neugotik, dem bevorzugten wilhelministischen Stil. Aber sie weist auch gespenstisch über den Roman hinaus auf die Kirchenruinen auf französischen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs hin. Durch eine Drehung ist die Kirchenbasis dann auch ein zerbrochenes, aber martialisches Kriegerdenkmal.

Theoretisch irritierend hat Eisenach auch alle Männerfiguren - und das sind in dieser patriarchischen Zeit fast alle - mit Schauspielerinnen besetzt. Die übernehmen dann auch gleich noch mehrere Rollen, da werkgetreu fast alle Romanfiguren auftauchen. Aber der Geschlechtertausch funktioniert ohne einen spürbaren Verfremdungseffekt, es entsteht dadurch sogar eine spürbare Aktualisierung: Von der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts könnten wir uns als Zuschauer noch bequem distanzieren, von reaktionärem Gedankengut, hier ausgesprochen wie von einer Schar Alice Weidels, Glorias von Thurn und Taxis oder Trad-Wifes, nicht.
Dramaturgisch geschickt - nach einer zunehmenden Beklemmung - setzt Eisenach nach anderthalb Stunden noch einmal einen tragikomischen Höhepunkt, in dem er die Proszeniums-Logen mitbespielt und uns Zuschauer im Parkett so zwischen einen aberwitzigen, rasendschnellen Schlagabtausch setzt. Es ist hier das letzte Gefecht des Liberalismus um Recht und Freiheit: der Prozess gegen den alten Buck wegen Majestätsbeleidigung, weil er Heßling und den Kaiser ein „Spatzenhirn“ genannt hat.
Aber auch dieses Gefecht geht im Sich-Ankeifen, Verächtlichmachen, Anbrüllen unter Szenenapplaus des Publikums verloren. Das Gericht ist bereits parteipolitisch rechts unter Kontrolle, der Rechtsstaat nur noch Fassade. Nicht nur hier denkt man an die gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Totalumbaupläne der AfD, an die Justizverhöhnung und Aushöhlung eines Donald Trumps.
So ist mit diesem „Untertan“ dem Residenztheater exemplarisch gelungen zu zeigen, wie man einen Klassiker neu, deutlich aktuell und werktreu ohne bindende Texttreue, dabei aber sprachgewaltig dramatisieren kann. Und schauspielerisch kann man mit diesem Ensemble wirklich alle Register ziehen: ernst und satirisch zu gleich, turbulent, abwechslungsreich, intensiv.

