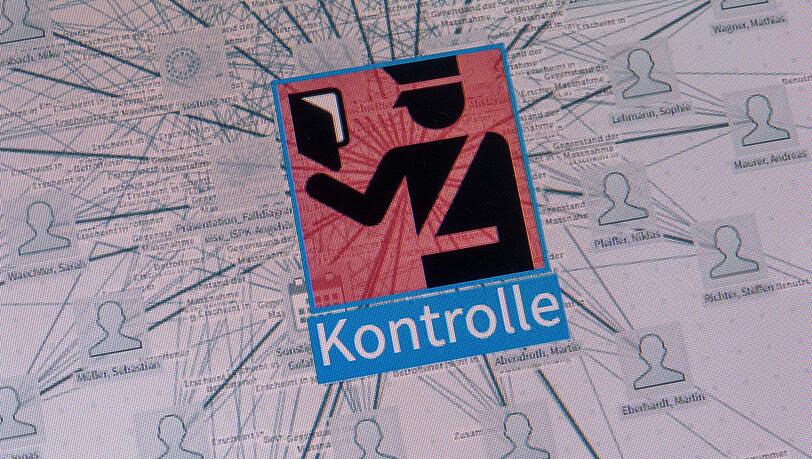So soll Missbrauch von Palantir-Software verhindert werden
Nach der Einführung der umstrittenen Palantir-Software VeRA bei der bayerischen Polizei haben die Beamten einen großen Teil der Nutzungen auf möglichen Missbrauch überprüft. 107 Mal sei das Analyse-Programm - mit vollem Namen "Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform" - bis Anfang Oktober genutzt worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit. Die Zahl der Stichproben zur Prüfung in diesem Zeitraum liege "in einem hohen zweistelligen Bereich". Auffälligkeiten habe es dabei nicht gegeben.
Zugriff auf zig Millionen Datensätze - nicht nur von Verdächtigen
Mit dem Programm lassen sich die verschiedenen Datentöpfe mit zig Millionen Informationen, die der bayerischen Polizei zur Verfügung stehen, in Sekundenschnelle durchsuchen. Dazu gehören nicht nur Angaben zu Verdächtigen, sondern auch zu Zeugen.
Um die Daten auszuwerten, übersetzt die Software unterschiedliche Dateiformate in ein gemeinsames Format. So können Ermittler Verbindungen erkennen und Informationen zur selben Person aus den verschiedenen Quellen zusammenführen. Angezeigt werden die Daten wahlweise in Netzwerken, auf Karten, in zeitlicher Abfolge oder als reine Texttabellen. Aus den Informationen lassen sich dann neue Dossiers erstellen.
Datenschützer kritisieren diesen umfangreichen Zugriff und die mögliche Verknüpfung von Daten, die zu völlig unterschiedlichen Zwecken gesammelt wurden. Analysten können dort je nach Fall Verbindungen zwischen Zeugen eines Unfalls und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zu Terrorverdächtigen feststellen und festhalten.
Privatdaten statt Verbrecher suchen? Wie das verhindert werden soll
Allerdings müssen die Analysten der Polizei, die die Software benutzen dürfen, bei jeder Suchanfrage zunächst angeben, zu welchem Zweck sie das Palantir-Programm nutzen. Bei weniger schwerwiegenden Gefahren können sie nicht auf besonders sensible Daten wie Erkenntnisse aus Abhöraktionen zugreifen, in dringenderen Fällen wie Terrorgefahr dagegen schon.
Um sicherzugehen, dass keiner der Beamtinnen und Beamten das Programm unberechtigterweise nutzt - zum Beispiel um den Wohnort von Prominenten oder Menschen aus dem privaten Umfeld zu suchen - werden die Suchanfragen stichprobenartig überprüft, teilt das LKA mit. Die Prüfer können dabei einsehen, wer wann welche Daten zu welchem angegebenen Zweck abgefragt hat.
Zuständig dafür sei die Projektleitung zur Software im LKA in Absprache mit dem Polizeipräsidium, aus dem die Suchanfrage kam. Eine genaue Zahl der Stichproben wollte das LKA auf Nachfrage nicht nennen.
Bei unberechtigten Abfragen werde zunächst geprüft, ob ein Verstoß gegen die Regeln zum Datenschutz vorliege, teilte das LKA mit. Betroffenen Beamten könne dann zum Beispiel der Zugriff auf die Software entzogen werden. In schwereren Fällen, etwa wenn sensible Daten weitergegeben werden, könne es auch strafrechtliche Ermittlungen geben.
Einsatz der Software sorgt in der Politik für Streit
Der Einsatz der Software von Palantir bei deutschen Polizeien ist politisch umstritten. Kritiker stoßen sich an den politischen Präferenzen von Mitgründer und Verwaltungsratschef Peter Thiel: Der US-Milliardär hatte in der Vergangenheit US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf unterstützt. Nach Angaben des Unternehmens ist Thiel aber nicht in das operative Tagesgeschäft involviert.
Datenschützer äußerten auch die Befürchtung, dass US-Geheimdienste über Palantir Zugriff auf deutsche Polizeidaten bekommen könnten - ein Vorwurf, den die Firma zuletzt vehement zurückwies. Ein solcher Datenabfluss sei "technisch ausgeschlossen", weil das Programm "ausschließlich" auf Servern der Polizei betrieben werde - ohne Anschluss ans Internet oder externe Server.
Neben der bayerischen Polizei nutzen auch Beamten in Nordrhein-Westfalen und Hessen die Software, in Baden-Württemberg soll sie nach dem Willen der Landesregierung bald eingesetzt werden. Einen Einsatz bei Bundesbehörden wollte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zuletzt prüfen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de