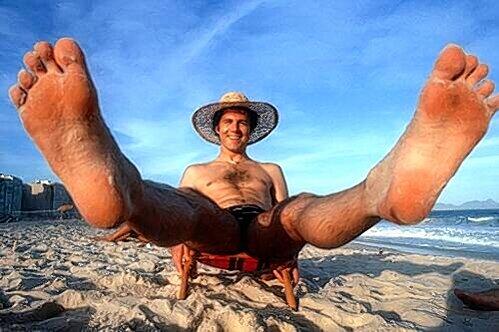Die Wahrheit über Beckenbauers Abschied
MÜNCHEN - Bayern verabschiedet Franz Beckenbauer feierlich – allerdings 33 Jahre zu spät. Die AZ klärt auf, warum das im ersten Anlauf gescheitert ist
Das Ende war das Letzte. Im Mai ’77, am 34. Spieltag gegen Gladbach, nüchtern und von ergreifender Schlichtheit. Da stand Franz Beckenbauer am Mittelkreis, da trug er zum 396. und letzten Mal in der Bundesliga das Trikot der Bayern, doch statt einer triumphalen Verabschiedung gab es drei Blumensträuße, eine Anstecknadel und kühle Worte von Bayern-Boss Neudecker.
Eine Würdigung, die unterdurchschnittlichen Auswechselspielern in der 2. Liga gerecht würde. Nicht aber einem Weltmeister und dreimaligen Europapokalsieger. Keiner Legende, keinem Kaiser.
Die Bayern und der Franz hatten sich nur noch wenig zu sagen vor dem Wechsel zum FC Cosmos. Weil das damals im Unfrieden endete, steigt das Abschiedsspiel für Franz Beckenbauer gegen Real Madrid eben erst am heutigen Freitag (21 Uhr, ZDF live). Aber warum war das so trostlos damals in den letzten Tagen in München, warum flüchtete Beckenbauer nach New York? Es ist an der Zeit, die wahre Geschichte des Franz-Abschieds zu erzählen. Letztendlich hat sie mit drei Dingen zu tun, denen viele Männer im Leben enorme Wichtigkeit beimessen: Fußball, Geld, Frauen.
Im Fußball war es mit der Herrlichkeit der Bayern 1977 längst vorbei. Das Viertelfinal-Aus im März gegen Kiew, aus der Traum vom vierten Landesmeister-Triumph am Stück, In der Bundesliga Mittelmaß. 0:7 gegen Schalke, 1:6 in Saarbrücken, 0:5 beim HSV, am Ende Platz 7, teilweise ernteten die Bayern nicht mehr Neid, sondern Mitleid.
Beckenbauer sah keine Perspektive mehr. „Ich werd’ ja bald 32“, sagte er damals, „aufwärts geht’s nimmer. Und das Angebot aus New York ist günstig.“ Sehr günstig: Verdiente er bei Bayern 400 000 Mark pro Jahr, so lockten in Amerika 2,3 Millionen. Weshalb er es dann auch leisten konnte, sich selbst bei den Bayern freizukaufen.
Die Verhandlungen zwischen Cosmos-Boss Clive Toye und Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker war quälend lang, nach Wochen der Feilscherei wollte Bayern 1,75 Millionen Mark, Minimum. Cosmos bot aber höchstens 1,4 Millionen. Also legte Beckenbauer die restlichen 350000 Mark selbst drauf.
Das war es ihm wert – angesichts der Millionen in Amerika. Daheim machte der Fiskus Druck, das Finanzamt wollte 500 000 Mark Nachzahlung, Beckenbauer verkaufte seine Villa in der Grünwalder Ludwig-Thoma-Straße, aber es war dann auch die öffentliche Stimmung, die ihn zermürbte und forttrieb. Sein Image war unten, und das lag am Aus(Schlamm)schlachten seines Privatlebens, seiner Affäre mit Diana Sandmann.
Öffentlich beklagte sich Beckenbauer über indiskrete Berichte ausgerechnet jenes Blattes, für das er heute als Kolumnist schreibt. „Es sind die unerfreulichsten Wochen meines Lebens“, sagte er damals, „jeden Tag Schlagzeilen aus den Betten des Franz Beckenbauer. Ich bin nicht dickhäutig. Das, was ich tue, muss ich nur meiner Frau Brigitte erklären.“ Was er auch tat, bevor er mit Sandmann (sie waren elf Jahre liiert) nach New York zog.
Das Denkmal bröckelte, die finale Demontage gab es dann im Mai 1977 durch Hellmuth Karasek im „Spiegel“: „Seit Heinrich IV. in Canossa sich seine bloßen Füße im Schnee wundstand, Ludwig II. im Starnberger See umnachtet baden ging und Wilhelm II. im holländischen Exil Bäume zersägte, ist keine Majestät im Bewusstsein der Nation so tief gesunken wie Kaiser Franz.“
Auch die „Süddeutsche“ sah Beckenbauer „vom Idol zum Reklamekasperl“ verkommen, statt Hochachtung gab es nur noch Hohn.
Aber letztendlich tat der Abstand gut. 1980, bei der Rückkehr in die Bundesliga zum Karriere-Ausklang beim HSV, da hatte das Land hatte wieder Respekt vor Beckenbauer, und später dann, als Teamchef der Neunziger-Weltmeister, da sah man die alten Brösel vor seinem Denkmal gar nicht mehr, vor lauter Millionen Menschen, die davor standen und ihm ehrfurchtsvoll huldigten, ihm, der Ausnahmeerscheinung des Weltfußballs.
Das zeigt sich ja allein heute. Wer bekommt denn sonst noch ein Abschiedsspiel nach 33 Jahren Warterei? Niemand. Nur eine Legende. Nur ein Kaiser.
Florian Kinast