Rassistische Worte: "In den Abfalleimer der Geschichte!"
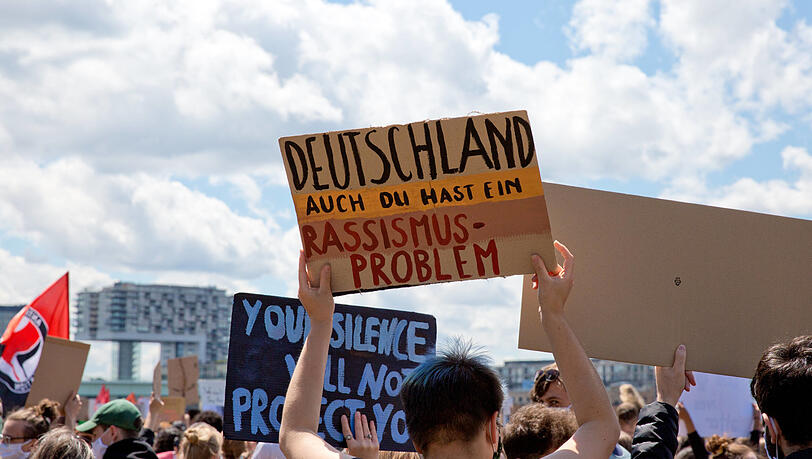
AZ-Interview mit Prof. Dr. Susan Arndt: Die Kulturwissenschaftlerin an der Universität Bayreuth forscht unter anderem zu Rassismus, Kolonialismus und Sprache.
AZ: Frau Arndt, wie reagieren Sie, wenn Sie im Jahr 2022 noch jemanden das N-Wort sagen hören?
Susan Arndt: Gerade weil wir uns im Jahr 2022 befinden und schon seit Jahrzehnten Debatten über Rassismus geführt werden, bin ich immer sehr irritiert, wenn Menschen das N-Wort weiterhin verwenden. Und ich bin auch davon irritiert, dass wir immer noch bei der Ob-Frage sind: Sollen wir diskutieren, ob das N-Wort rassistisch ist? Wenn Menschen behaupten, es zähle zur freien Meinungsäußerung, müssen sie auch damit umgehen können, dass ich es als rassistisches Handeln werte.

Rassistischer Anteil in der deutschen Sprache ist klein
Wie ist Ihre Einschätzung: Wie viel Rassistisches steckt in der deutschen Sprache?
Wenn man sich den riesengroßen Wortschatz anschaut und dann den Anteil an rassistischen Wörtern, ist es eigentlich ein kleiner Anteil. Dennoch ist das Problem, dass es bisher in Deutschland keine adäquate und ausreichende Aufarbeitung und Erinnerungspolitik in Sachen Kolonialismus gibt.
Inwiefern?
Ganz viele Vorstellungen, die der Kolonialismus gesät hat, um Unrecht als Recht zu verkaufen, existieren bis heute. Es wurden rassistische Wörter geprägt, die zum Ziel hatten, Menschen das Menschsein abzusprechen. Aber auch in harmlosen Konzepten wie Demokratie, Nation, Feminismus, Entwicklung oder auch Fortschritt schwingt immer noch mit, dass all das in der europäischen und nordamerikanischen Kultur gegeben ist und andere Gesellschaften auf anderen Kontinenten es nicht hätten. Die Auseinandersetzung mit rassistischen Begriffen ist also das eine, aber es ergibt nur Sinn, wenn dies in die Frage eingebettet ist, welche Grundvorstellungen der Kolonialismus hervorgebracht hat.
"Viele denken, Indianer sei ein wertschätzender Begriff"
Es ist paradox: Über die Verbrechen in den deutschen Kolonien, sei es gegen die Herero und Nama in Namibia, oder auch beim Maji-Maji-Krieg in Tansania, wissen viele nur wenig. Rassistische Vorstellungen und Begriffe haben sich dagegen Jahrzehnte lang gehalten. Warum ist das so?
Ich glaube, das hängt zusammen. Weil diese Zeit nicht kritisch reflektiert wird, gibt es bei vielen auch keine Irritation, keine Fragezeichen oder Abwehrreaktion. Viele denken auch, das I-Wort - Indianer - sei ein wertschätzender Begriff, weil man damit die Naturverbundenheit ehre. Aber wenn man genau hinschaut, steckt dahinter die rassistische Vorstellung: je mehr Natur, desto unterlegener, und je mehr Kultur, desto überlegener. Das war das Mantra des Kolonialismus.
Deutschland hat sich sehr lange schwergetan mit einem Wort, wenn es um den grausamen Umgang mit Herero und Nama in Namibia geht: Völkermord. Ist auch das ein Problem, dass das Passierte selbst von offizieller Seite so zögerlich benannt wird?
Mittlerweile wird es langsam verwendet. Aber was immer noch fehlt, ist eine angemessene Reaktion von staatlicher Seite darauf. Solange mit einer solchen Entschuldigung herumgewabert wird, wird sich das Bewusstsein, dass Deutschland einen Genozid in Namibia begangen hat, nicht breit installieren. Die verbreitete Haupterzählung ist allgemein weiterhin, Deutschland sei ja nur kurz Kolonialmacht gewesen. Als ob es eine Frage der Länge wäre! Wenn man nur 1884 bis 1914 nimmt, sind das immer noch 30 Jahre. Für mich ist es wichtig, hier historisch ganzheitlicher zu denken und Kontinuitäten aufzuzeigen.
"Wörter können Gewalt ausüben"
Sie setzen bei der Aufarbeitung bei der Sprache an. Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig, wenn man gegen Rassismus und koloniale Denkweisen kämpfen will?
Sprache tut weh - das kennen wir alle, wenn wir uns in einem Konflikt befinden. Wörter können Gewalt ausüben und das tun sie permanent. Sprache bildet nicht einfach nur ab, sondern wir sind, was wir uns sagen. Mit Wörtern drücken wir eine bestimmte Perspektive auf die Welt und auf andere Menschen aus. Ich sage: Sprache handelt und wir handeln durch Sprache. Es ist kein Nebenkriegsschauplatz, sondern damit sind wir mitten drin in der Frage, wie wir in der Gesellschaft mit Rassismus umgehen wollen. Sich dafür zu entscheiden, einen rassistischen Begriff zu verwenden, ist keine neutrale und auch keine objektive Positionierung.
Von bestimmten Wörtern ist allgemein bekannt, dass sie diskriminierend sind - das M-Wort etwa. Bei anderen Begriffen ist es nicht so offensichtlich. In Ihrem neuen Buch nennen Sie zum Beispiel "Entdeckung" als problematisch im Zusammenhang mit Kolonien. Können Sie das ausführen?
Entdecken kann man eigentlich nur etwas, was Menschen noch nicht bekannt ist. Als beispielsweise Kolumbus das heutige Amerika erreicht hat, beschrieb er es als unentdecktes Land. Damit ist er mit einer Weltsicht herangegangen, als hätten die Menschen, die dort lebten, keinen Anspruch auf die Ländereien und Ressourcen. Gleichzeitig bedurfte es enormer Gewalt, diese Menschen zu unterwerfen. Das dann "entdecken" zu nennen, ist bestenfalls ein Euphemismus. Es ist eine Verschleierung von Gewalt und insofern ein verharmlosender, verleugnender Begriff. Genau genommen ist auch Kolonialismus ein beschönigender Begriff, weil er vermuten lässt, es handle sich um ein Besiedeln und das Gestalten der Natur zur Kultur. Aber Kolonialismus ist eine Gewaltherrschaft.
Wie kann man als Gegenüber reagieren, wenn jemand heutzutage noch rassistische Begriffe verwendet?
Alle Argumente sind da, sie liegen auf dem Tisch, in Büchern, in Sozialen Netzwerken vor. Häufig wird gesagt: Wenn ich Rassismus anspreche, entzweie ich die Gesellschaft. Nein! Die Entzweiung passiert durch den Rassismus. Deswegen rate ich: sich mit den vorliegenden Argumenten auseinandersetzen und nicht hinter der Frage verstecken, sollen wir uns damit beschäftigen oder nicht. Die Antwort sollte 2022 wirklich sein: Ja, es ist überfällig!
Viele mögen mittlerweile auch unsicher sein, was als politisch korrekt gilt. Schützt Unwissen vor rassistischen Äußerungen?
Beim ersten Mal würde ich sagen, okay - aber ab dann weiß man es.
"Wir können über Jahrhunderte gewachsene rassistische Begriffe nicht umdeuten"
Und wenn der Gegenüber sagt, er habe es doch gar nicht so gemeint?
Wir können nicht als Individuum darüber entscheiden, was ein bestimmtes Wort meint. Wenn ich einen Apfel nehme und sage, es ist eine Birne, sind wir uns alle einig, dass ich nicht die Macht habe, die Bedeutung eines Wortes zu ändern. Genauso können wir über Jahrhunderte gewachsene rassistische Begriffe nicht umdeuten. Deswegen sollten diese Wörter dort belassen werden, wo sie hingehören: im Abfalleimer der Geschichte.
Auch dass man gar nichts mehr sagen dürfe, ist eine beliebte Ausrede. Warum tun sich manche so schwer, rassistische Begriffe als solche zu akzeptieren?
Zuerst: Die Aussage ist schlichtweg falsch, es gibt ausreichend Alternativbegriffe. Rassismus wurde aus einer weißen Machtposition geprägt, die Weißsein als Norm bestimmt hat. Damit hatte man Zugriff auf Privilegien, darunter auch, andere zu benennen und zu bezeichnen und sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Das wird in dem Moment infrage gestellt, wenn wir uns als weiße Personen eingestehen: Wir sind in Deutschland von Rassismus betroffen, Weiße haben Rassismus erfunden und ihn gebraucht. "Jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen", heißt eigentlich: Ich verliere etwas, was für mich selbstverständlich war. Daher kommt oft auch die aufgebrachte, verärgerte, aggressive Reaktion von weißen Menschen. Sie versuchen sich als Opfer, Geschädigte oder Diskriminierte zu generieren. Das erlebe ich in meiner Arbeit immer wieder.
Wie stehen Sie zu Bezeichnungen wie Schwarzer Deutscher oder Afrodeutscher - warum nicht einfach Deutscher?
Auch wenn das Gesetz sagt, alle sind gleich, wird damit nicht anerkannt, dass es Menschen gibt, die diskriminiert werden. Diese Tatsache wird damit unsichtbar. Deswegen muss es benannt werden. Die betroffenen Communitys haben sich über Jahrzehnte mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie sich nennen wollen. Gemäß: Wir sind Deutsche, aber wir werden dennoch ausgegrenzt. Bei "Schwarzen Menschen in Deutschland" wird der Fokus aufs Menschsein gelegt, ebenso bei "People of Color" (PoC). Es ist wichtig, diese Positionierung sichtbar zu machen, ohne Rassismus zu reproduzieren.
Nicht nur in gesprochener Sprache begegnen uns Diskriminierungen. Selbst in Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf wird über die Menschen im Kongo etwa gesagt, sie würden von früh bis spät lügen. Wie geht man am besten damit um?
Ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, solche Sachen in einem Vor- oder Nachwort einzuordnen. Rassistische Wörter können in solchen Übersetzungen gut ersetzt werden. Dargestellte Stereotype kann man dagegen nicht einfach durchstreichen. Aber ich fände es gut, sie zielgruppengerichtet einzuordnen und den Kontext herzustellen, dass bei der Entstehung des Buches Rassismus noch nicht so wie heute reflektiert wurde.
Wie lange wird es den Kampf gegen rassistisches Erbe aus der Kolonialzeit noch geben?
Das wird schon noch eine Weile dauern, es ist über die Jahrhunderte gewachsen und es ist systemischer Rassismus. Das bedeutet, es äußert sich in Institutionen, durch Wissenskonzepte, durch Moralvorstellungen. Rassismus strahlt in alle Poren der Gesellschaft aus und wirkt in sie hinein. Er kann deswegen nur systemisch bekämpft werden - durch ständige Wiederholung, in der Gesetzgebung, in Schulbüchern und so weiter. Der erste Schritt ist aber, den Rassismus als systemische Katastrophe der Menschheit anzuerkennen und sich einzugestehen, dass es ein harter Kampf ist. Davon darf man sich zugleich nicht entmutigen lassen.
Susan Arndt: Rassistisches Erbe. Wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen, Duden Verlag, 22,70 Euro

