Fiktion mit einem Fünkchen Wahrheit: Lehrer schreibt München-Sagen
München - Das Surfen kommt aus München, Eichhörnchen bringen Glück und der Dackel wäre beinahe das Wappentier der bayerischen Landeshauptstadt geworden. Stimmt's? Natürlich nicht. Aber es könnte stimmen! Mit diesem Gefühl lässt einen Bastian Mahler stets zurück, wenn man seine neuesten Münchner Sagen liest. Ein Gespräch am Neuhauser Friedhof über Fake News, Urängste im Wald und dressierte Wildschweine.
AZ: Herr Mahler, leiden Sie an einem Baron-von-Münchhausen-Syndrom?
BASTIAN MAHLER: (lacht laut) Sie meinen das im Sinne von: zwanghaft Lügen?
Ja.
Ein wenig vielleicht. Damit kann ich leben. Aber mit einem doch sehr großen Unterschied zum Lügenbaron.
Nämlich?
Ich sage von vornherein: Das, was ich erzähle, stimmt so nicht – auch in meinem Buch. Das ist ja bei Baron von Münchhausen anders gewesen.
Haben Sie als Kind viele Geschichten erfunden, um sich aus unangenehmen Situationen herauszuwinden, weil Sie Mist gebaut haben?
Nein. Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich weiß, war ich relativ pflegeleicht.
Und wenn wir jetzt Ihre Mutter fragen würden...
... würde sie das auch sagen, ziemlich sicher.
Woher kommt dann Ihre Neigung, Geschichten zu erfinden?
Weil ich die Leute unterhalten will. Und weil es Geschichten sind, die es so nicht gibt.
Wie meinen Sie das?
Nehmen wir den Rotkreuzplatz, den Brunnen mit den beiden steinernen Figuren. Die Wahrheit ist: Ein Künstler durfte sich hier verwirklichen, mehr weiß man von den beiden nicht. Schade, es wäre doch viel schöner, eine Geschichte dazu zu haben, wie ich sie erfunden habe. Wenn Sie vorbeilaufen, erinnern Sie sich daran.
Wie lautet Ihre Geschichte dazu?
Dass damit an zwei Marktleute vom Rotkreuzplatz erinnert wird, die besonders grantig und unfreundlich waren. Sie schütteten nach Feierabend Abfälle unter die Stände der Konkurrenz, was zu einem brutalen Gestank führte – und dazu, dass Ratten sie befallen haben. Schließlich wurden sie für ihr Verhalten bestraft. Das ist die zweite Sage in meinem Buch.

Wie kamen Sie darauf?
Ich wohnte früher hier in der Nähe. Als Kind bin ich auf diesen Figuren herumgeturnt. Und es gab wirklich eine Standbetreiberin, die immer besonders unfreundlich war. Sie verkaufte Obst. Da habe ich weitergesponnen. Es machte richtig Spaß.
Es ist also ein Funken Wahrheit in Ihrer erfundenen Sage.
So ist es.
"Das Surfen wurde in München erfunden? Traut man uns doch zu!"
Im Titel ihres Buches beziehen Sie sich auf die erste Sage im Buch: Wie die Isarflößer das Surfen erfanden.
Ja, das traut man doch den Münchnern zu. Schließlich gibt es das urbane Surfen am Eisbach. Und ich bette hier die Erfindung des Surfens ein, in eine Geschichte, wie Isarflößer einen ihrer Kollegen ins Wasser werfen wollten. In Thalkirchen. Aber er blieb stehen, auf einer losen Holzplanke. Er balancierte auf einer stehenden Welle. Das Surfen war geboren – und die Amis haben es sich hier abgeschaut.
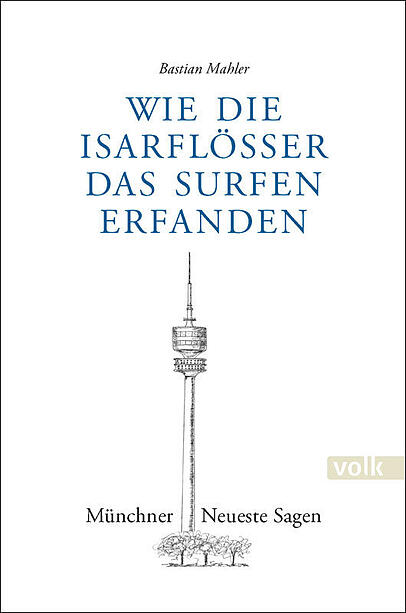
Aber haben Sie nicht Angst, dass Sie in Zeiten von Fake News und Informationsgewaber für noch mehr Verwirrung sorgen?
Nein, überhaupt nicht. Sagen sind immer eine Mischung aus Fiktion und einem Fünkchen Wahrheit. Wie gesagt: Wer mein Buch liest, weiß von Anfang an, dass der Kern der Geschichten erfunden ist. Bei Märchen fragt ja auch keiner danach. Wissen Sie, es ist sehr wichtig, mal gezielt Geschichten zu erfinden oder Fehlinformationen zu entwickeln.
Auf die Erklärung bin ich jetzt gespannt.
Ich habe mal ein Geschichtsseminar in der Schule angeboten. Es hieß: Geschichte fälschen. Die Schüler sollten eine Ausstellung machen zum zwanzigjährigen Jubiläum der Schule. Sie sollten aber schlüssig behaupten, dass die Schule schon hundert Jahre alt ist.
Klingt spannend. Wie gingen die Schüler vor?
Der eine hat Sütterlin gelernt, diese alte Schrift, um Quellen zu fälschen, fast schon wie im Film Schtonk! Der nächste hatte alte Geschichtsbücher organisiert und den Schulstempel eingesetzt. Alte Fotos wurden besorgt und so drapiert, dass alles stimmig aussieht. Und die Schüler haben einen falschen Wikipedia-Artikel verfasst, der sogar zwei Tage online war. Er wurde nur gelöscht, weil wir einen Nobelpreisträger erfunden hatten, der ehemaliger Schüler des Gymnasiums gewesen sein sollte. Und wissen Sie, was die Schüler danach gesagt haben? Dass sie jetzt Falschinformationen im Netz besser erkennen.
Warum?
Fake News müssen ja in sich schlüssig sein, um nicht gleich als Lüge aufzufliegen. Aber sie haben natürlich ihre Lücken. Und wenn man selbst versucht, lückenlose Falschinformationen zu erfinden, wird man dafür sensibilisiert, was an einer Geschichte nicht stimmen könnte.
Das heißt, viele Rahmenbedingungen in Ihren Buchgeschichten mussten stimmen, damit die falsche Sage schlüssig klingt?
Absolut. Ein Beispiel: Bei der Sage rund um den Eber am Jagdmuseum musste ich ziemlich viel recherchieren. Darin geht es ja um ein unverkäufliches Wildschwein auf dem Viehmarkt, das dressiert war wie ein Hund. Deshalb will ihn ein reicher Münchner unbedingt kaufen und bietet viel Geld. Und dieser halbliegende Eber – diese weltweit berühmte Tierskulptur Münchens – ist meiner falschen Sage nach diesem dressierten Wildschwein nachempfunden.

"Manchmal wird einem auch die Wahrheit nicht geglaubt"
Den Münchner Viehmarkt mitten in der Stadt gab es wirklich?
Ja. Es bringt nichts, wenn die Leute von vornherein sagen: Ach so ein Quatsch, diesen Viehmarkt gab es ja gar nicht, das ist komplett frei erfunden. Da liest kein Mensch weiter. Auch die berühmtesten Märchen lassen einen schließlich mit dem Gefühl zurück, dass das alles wahr sein könnte. Außerdem, das dressierte Schwein ist nicht vollkommen frei erfunden.
Sie haben mal ein dressiertes Wildschwein gesehen?
Als Schüler war ich zum Austausch in Texas. Die Familie, bei der ich wohnen durfte, hatte ein echtes Wildschweinproblem. Aber die haben die Tiere nicht geschossen, sondern eingefangen und weiterverkauft. Als mein Gastgroßvater wieder einmal ein paar Schweine zum Verkauf brachte, war sein Hund dabei. Er sagte zu ihm: "Sitz!" – und eines der Schweine setzte sich auch. Er dachte, das muss Zufall sein. Er sagte noch einmal: "Sitz!" Das Schwein setzte sich wieder. Das fand er so faszinierend, dass er das eine Schwein behalten hat. Es ist dann an Altersschwäche gestorben.
Kommt es vor, dass man Ihnen eine echte Geschichte innerhalb der Sagen nicht mehr abkauft?
Absolut. Manchmal wird die Wahrheit stark hinterfragt, weil sie kaum zu glauben ist – und für unwahr erklärt. Eine Kollegin von Ihnen, mit der ich für mein Buch gesprochen habe, sagt: Also das mit dem Sarcletti am Rotkreuzplatz, da haben Sie wirklich übertrieben. Dieses Eiscafé gibt es doch noch keine hundert Jahre. Aber tatsächlich ist es so. Die Familie Sarcletti ist fast genau an dieser Stelle seit etwa 100 Jahren.
"Ich musste erst wissen, ob es im 17. Jahrhundert Kartoffeln gab"
Wie gingen Sie bei der Sage rund um den Bergwolf vor?
Der vergessene Held der Sendlinger Mordweihnacht. Rund um diese Geschichte erfinde ich ja den Gründungsmythos des Bergwolf. Ich dachte mir, so, wie bette ich jetzt Currywurst und Pommes da ein? Da brauche ich ja Kartoffeln. Gab es die da schon? Und tatsächlich, in Österreich waren Kartoffeln im 17. Jahrhundert schon verbreitet. Vor allem in Kirchen und Klöstern. Und so konnte ich eine Verbindung zur Sendlinger Kirche herstellen und die erfundene Sage aufschreiben.

Ich gehe mal davon aus, dass Märchen eine wichtige Rolle in Ihrer Kindheit gespielt haben.
Nicht nur die. Auch die Legenden rund um den schwäbischen Ort, in dem ich aufgewachsen bin.
Wo sind Sie groß geworden?
In Hechingen bei Tübingen.
Welche Geschichten geistern dort herum?
Die des Hagemann im Wald zum Beispiel.
Ist das eine der ersten Sagen Ihres Lebens?
Eine, an die ich mich sehr gut erinnern kann jedenfalls. Ich hatte Angst. Wir wohnten am Wald.
"Mit Angst läuft man im Dunkeln schneller durch den Wald"
Wer oder was war oder ist der Hagemann?
Es hieß, der Hagemann, der geistert im Wald und lässt Leute verschwinden. Jeder wusste, dass das ein Märchen ist. Aber im Hinterkopf dachten vor allem Kinder: Wer weiß, vielleicht ist ja doch was dran. Da läuft man im Dunkeln gleich etwas schneller durch den Wald.
Was machen solche Geschichten mit den Menschen, außer Angst zu erzeugen?
Sie lassen sie abschalten und an etwas Anderes denken als den Alltag, egal wie absurd sich das alles anhört.
Absurd? Jede Sage muss in sich schlüssig sein, haben Sie vorhin gesagt.
Klar, aber man darf es nicht übertreiben. Die Sage ist ja nicht anstelle der Wahrheit da. Sie ist pure Fantasie. Ich verstehe auch nicht, wenn die Leute sagen: Diese Vampire bei der Serie Twilight, die können nicht bei Tageslicht herumlaufen. Aber jeder weiß: Es gibt keine festgeschriebenen Regeln für Vampire. Also warum regt man sich da eigentlich auf?
Wahrheit und Fiktion – Sie sind Lehrer für Deutsch und Geschichte. Hat das alles irgendetwas mit Ihrem Beruf zu tun?
Natürlich. Nehmen wir Faust. Das ist eine völlig konstruierte Geschichte. Fiktionale Realität. Ob Faust wirklich existiert hat oder nicht, das ist für das Drama wurscht. Und Geschichte als Wissenschaft: Die ist rekonstruiert aus Informationsquellen und Fakten. Da müssen auch Lücken gefüllt werden. Viele Diktatoren versuchen ja, die Geschichte umzudeuten, indem sie die Lücken anders füllen. Da muss man lernen, mit den richtigen Quellen zu arbeiten, damit sich am Ende nicht Fake News durchsetzen.
Was ist eigentlich Ihre Lieblingssage in dem Buch?
Der Titel, die Isarflößer. Aber die Rotkreuzplatzgeschichte finde ich auch schön. Am allerschönsten finde ich, wenn mich Leser kontaktieren und erzählen, welche ihre Lieblingssage aus dem Buch ist. Und warum.
- Themen:
- München








