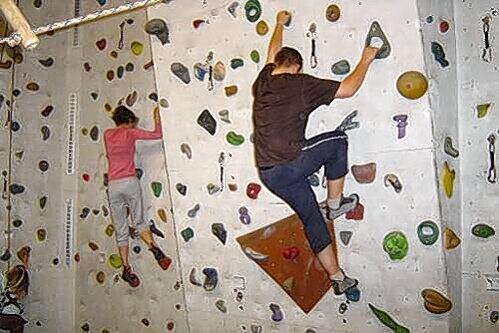Essstörungen und Depressionen: So kann man Kindern helfen
HARLACHING - Nikolaus von Hofacker im AZ-Gespräch: Der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik am Klinikum München-Harlaching erklärt, wie psychische Krankheiten bei Kindern entstehen und was man tun kann.
AZ: Macht unsere Leistungsgesellschaft schon die Kinder krank?
Nikolaus von Hofacker: Immer mehr Kinder und Jugendliche reagieren mit Angst, Panik und Depressionen auf den wachsenden Stress in unserer Gesellschaft. Wir stellen in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von psychischen Erkrankungen bei Kindern- und Jugendlichen fest. Aktuelle Studien belegen: Jedes fünfte bis sechste Kind hat handfeste psychische Probleme, bei jedem zehnten Kind treten schwere Symptome auf. Was wir vor allem sehen, ist eine deutliche Zunahme schulbezogener psychischer Probleme. Deshalb haben wir für betroffene Kinder ein neues, ganzheitliches Therapiekonzept in unserer Tagesklinik erarbeitet.
AZ: Welche Krankheitssymptome entwickeln Kinder und Jugendliche?
Manche Kinder reagieren mit Symptomen wie Angst. Das kann Angst vor schulischen Belastungssituationen sein. Meistens haben sie aber bereits Angst, von Zuhause wegzugehen, das Elternhaus und die Familie zu verlassen, sich zu trennen und in die Schule zu gehen: Sie haben Angst davor, dass in ihrer Abwesenheit Zuhause irgendetwas Schlimmes passieren könnte - zum Beispiel, dass sich die Eltern streiten, sich trennen oder gar sterben könnten. Andere Kinder reagieren mit Depressionen oder mit körperlichen Symptomen wie chronischen Kopf- oder Bauchschmerzen. Wieder andere Kinder tragen die Symptome nach außen: Sie reagieren aggressiv, also mit sozialen Problemen. Das sind häufig eher die Buben, die sich im schlimmsten Fall dissozial, kriminell entwickeln können. Wir behandeln vor allem die so genannten internalisierenden Erkrankungen wie Depressionen, Ängste, psychosomatische Beschwerden, atypische Essstörungen.
Was macht die Kinder eigentlich krank?
Unser Verständnis dessen, was krank macht, ist ein multifaktorielles. Das heißt, dass es ganz viele verschiedene Faktoren gibt, die sich summieren. Je mehr Belastungsfaktoren zusammen kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind oder Jugendlicher psychisch krank wird. In dieser Hinsicht ist Stress durch ständigen Leistungsdruck in der Schule mittlerweile ein ganz wesentlicher Faktor geworden, aber auch die Zu- und Verplanung des Alltags der Kinder und Jugendlichen durch die Schule. Im Gymnasium entspricht heute der Wochenstundenplan im G 8 häufig einem Vollzeitjob. Es bleibt daneben einfach viel zu wenig Zeit für kreative Bereiche und sportliche Aktivitäten. Durch diese Verarmung kreativer und sportlicher Fähigkeiten und Aktivitäten kommt es zu einem mangelndem Ausgleich von Stress. Kinder und Jugendliche haben heute viel weniger Möglichkeiten, ihre Ressourcen zu regenerieren, also wieder aufzutanken, Kraft zu sammeln und einen guten Ausgleich zu haben gegenüber diesem Übermaß an schulischen Anforderungen. Wenn dann die Familie nicht mehr 100-Prozent Rückhalt bieten kann, sondern es auch dort noch Stress gibt, bricht den Kindern und Jugendlichen der wesentliche Rückhalt weg. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass sie psychische Symptome entwickeln.
In welchem Alter beginnt diese negative Entwicklung ?
Der Stress beginnt heute schon im Kindergarten: Im Zuge einer gewissen Hysterisierung der Pisa-Studie wollen viele Eltern das Beste für ihre Kinder zum frühest möglichen Zeitpunkt tun. Tatsächlich ist es heute so, dass viele Kinder schon von frühem Kindesalter an in einem Maße gefördert werden, wie wir es als Fachleute nicht mehr für entwicklungsförderlich halten. Die beste Förderung von Kleinkindern sind gesunde Eltern-Kind-Beziehungen. Und dazu gehört vor allem auch Spiel und nicht nur einfach pädagogische Förderung. Spielen sollte ein ganz wesentlicher Teil des kindlichen Tagesablaufes sein, der heute leider immer mehr verloren geht. Die Fähigkeit von Erwachsenen, sich einfach nur spielerisch mit ihren Kindern zu beschäftigen, geht wirklich verloren. Dafür werden die Kinder heute von einer pädagogischen Aktivität zur nächsten „gekarrt“, während für das Kreative und Spielerische im Alltag der Kinder kaum noch Platz ist. Dabei sammeln sie gerade dabei ganz wertvolle Erfahrungen und Lernmöglichkeit. Und genau das geht vielen Kindern heute verloren.
Stichwort Finanzkrise und Angst um den eigenen Arbeitsplatz: Überträgt sich der Stress der Eltern bereits auf den Nachwuchs?
Ja, eindeutig. Viele Eltern sind heute selber immer mehr und komplex belastet und dadurch in ihren Beziehungen zu ihren Kindern weniger oder nicht ausreichend verfügbar. Der Stress, die steigenden Existenz- und Zukunftssorgen der Eltern können sich also zusätzlich auf die Kinder übertragen.
Gibt es noch weitere Ursachen?
Eltern und Familien sind heute häufig extrem verunsichert darüber, was in der Erziehung sinnvoll ist und was nicht. Es gibt eine mediale Überflutung von Ratgebern, die dazu beitragen. Wir erleben immer mehr Eltern, die sich schon wegen banal erscheinender pädagogischer Probleme psychotherapeutische Hilfe holen, weil sie so verunsichert sind. Ein weiterer Faktor ist der vielfache Zusammenbruch herkömmlicher Familienstrukturen. Wir haben unter unseren Patienten sehr viele Patchworkfamilien, wo unterschiedliche Halbgeschwister aus unterschiedlichen Beziehungen der Eltern stammen und für die Kinder die eigentliche Familie ein recht unübersichtliches Gebilde geworden ist, so dass es keine so eindeutige Verankerung mehr gibt wie früher.
Und die Väter?
Die Rolle der Väter liegt mir sehr am Herzen: Wir haben heutzutage wesentlich engagiertere Väter wie früher. Mit einem hohen Anspruch an sich selbst und die Familie. Trotzdem haben wir bei den vielen Trennungsfamilien häufig nicht ausreichend verfügbare Väter, und auch innerhalb der Familie stehen in der Realität den Kindern Väter oft nicht ausreichend zur Verfügung. Auch das soziale und pädagogische Umfeld ist ja weitgehend von Frauen dominiert. Es gibt in den Kindergärten, in den Tagesstätten, in den Krippen überwiegend weibliche Betreuer. Es gibt viel zu wenig männliche Betreuungspersonen, das liegt z. T. auch daran, dass in unserer Gesellschaft soziale Berufe nach wie vor finanziell wie auch vom Ansehen her keine ausreichende Wertschätzung erfahren. Als Folge dieser Entwicklung fehlt den Kindern häufig ein väterliches Gegenüber in ihrer sozialen Umwelt. Das hat nicht nur für die Buben, auch für die Mädchen nachhaltige Auswirkungen. Väter fördern die Auseinandersetzung mit Neuem, mit Ungewohntem, die Explorationsfreude des Kindes. Väter, das zeigt die neuere Väterforschung, erklären ihren Kindern die Umwelt sehr viel intensiver. Väter setzen auch in bestimmten Situationen klarer Grenzen, vermitteln Stabilität und Sicherheit. Auch in bedrohlichen und unsicheren Situationen. Das sind Funktionen, wo sich Väter und Mütter üblicherweise sehr gut ergänzen können. Auch Mütter können solche Anteile übernehmen, wenn die Väter nicht verfügbar sind, aber das ist sehr anspruchsvoll, wenn Mütter auch noch diesen Teil mit übernehmen müssen. Das ist natürlich keine biologische, sondern eine Sozialisierungsfrage. Auch Väter können mütterliche Anteile übernehmen und umgekehrt. In einer gesunden Elternbeziehung wäre es das Ideale, wenn beide Eltern beide Anteile übernehmen können. Beide Rollen, fordernd-fördernd und umsorgend, sind für Kinder gleichermaßen wichtig und gut.
Was können Eltern bei Ihnen in der Tagesklinik lernen?
Wenn Familien zu uns kommen, fragen wir nicht, wer was falsch macht, sondern wir versuchen zu verstehen, unter welchen Bedingungen Kinder in der Familie psychische Probleme entwickeln. Und das tun wir ohne Schuldzuweisung, weil das Bedingungsgefüge zu komplex ist, als dass man sagen könnte, einer ist schuld oder eine hat was falsch gemacht. Trotzdem wollen Eltern natürlich wissen, was sie besser oder anders machen können. Wir sagen zu ihnen: Das Wichtigste ist, dass Erziehung nur in der Beziehung abläuft. Wir helfen den Familien also, wirklich miteinander in Beziehung zu gehen und vor allem Konfliktsituationen nicht auszuweichen, sondern sie konstruktiv zu lösen. In jeder gesunden Familie entstehen täglich unterschiedliche Konfliktsituationen. Die Kunst besteht darin, solchen Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, nicht gewaltsam zu reagieren, sondern sie miteinander konstruktiv zu lösen.
Welche Rolle spielt der wachsende Leistungsdruck in den Schulen?
Die Leistungsvergleiche, die in den Schulen gemacht werden, führen zu einem frühzeitigen Leistungsanspruch und vor allem -druck der Kinder, bringen aber vergleichsweise wenig. Man kann auch ohne Noten individuelle Leistungsbewertungen vornehmen. Das einzelne Kind braucht und möchte in der Schule durchaus eine Rückmeldung, wie es seine Leistung einzuschätzen hat. Smileys allein helfen dabei aber als Alternative zu Noten wenig. Das Kind braucht am besten eine möglichst konkrete Bewertung, wie es seine Leistung einzuschätzen hat. Sicher wollen sich Kinder in höherem Alter auch mal mit anderen Kindern messen. Aber es gibt meiner Einschätzung nach eine Überbewertung der Leistungsvergleiche durch Noten. Es gäbe auch andere Möglichkeiten der Leistungsbewertung, die konstruktiver sind. Eine starke Abhängigkeit des weiteren Schulerfolgs und der Schullaufbahn von einer Leistungsbewertung durch Noten ist häufig nicht konstruktiv.
Gibt es Kinder, die besonders gefährdet sind ?
Bei Kindern mit psychischen Problemen liegen häufig Wechselwirkungen zwischen individuellen Persönlichkeits- und Temperamentsmerkmalen des Kindes in Verbindung mit ungünstigen Umweltbedingungen vor. Solche schwierigen Temperamentsmerkmale von Kindern sind zum Beispiel, dass manche Kinder auf Neues nicht positiv-offen, sondern skeptisch-zurückhaltend reagieren. Oder dass Kinder auf Stress nicht mit Selbstvertrauen reagieren nach dem Motto "Ich kann den Stress bewältigen", sondern miss- und übellaunig und schnell negative emotionale Reaktionen zeigen, auch schon bei kleinerem Stress. Dann geraten solche Kinder schnell in ungünstige Denkabläufe: „Ich kann das ja eh nicht, wie soll ich das nur schaffen, ich bin ja viel zu dumm“. Auch ein hoher Perfektions- und Selbstanspruch kann den Kindern erheblich zu schaffen machen. Kinder, die es „lässig“ angehen, haben es oft leichter. Wenn dann auch noch in den Familien Disharmonien, Streitigkeiten, ungelöste Konflikte, Spannungen, extrem hohe Leistungsansprüche und Druck, psychische Erkrankungen eines Elternteils oder auch Alkohol- und Gewalttätigkeiten auftreten, dann kann sich die Situation schnell ungünstig aufschaukeln. Für Eltern kann es übrigens auch mal entlastend sein, zu hören, dass das besondere Temperament ihres Kindes es ihnen in manchen Situationen schwer macht, „gute“ Eltern zu sein.
Ist es typisch, dass gerade kleinere Kinder bei psychischen Krisen zunächst mit körperlichen Symptomen reagieren?
Ja. Häufig reagieren Kinder auf Probleme in Schule, Alltag und Familie zunächst mit körperlichen Symptomen wie chronischen Kopf- oder Bauchschmerzen. Leistungsabfall und ein Kreislauf von Angst, Panik und Depressionen können folgen. Je nach Alter und Entwicklungsphase gibt es dabei unterschiedliche Reaktionsweisen von Kindern. Auf unserer Eltern-Säuglings-Station, wo wir Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern bei psychischen Problemen gemeinsam behandeln, sehen wir z. B. häufig Babys, die nicht mehr richtig essen, die Nahrung verweigern. Das kann so weit gehen, dass sie nur noch über Sonde ernährbar sind. Andere haben schwere Schlafstörungen, oder zeigen tagsüber extreme Wut- und Trotzanfälle. All dies sind Kinder, die, wie wir sagen, Probleme haben, sich selber ausreichend zu regulieren. Solche Regulationsprobleme sind ganz eng verknüpft mit der Qualität der frühen Eltern-Kind-Beziehungen, die Regulation des Säuglings oder Kleinkindes und die Regulation der Eltern-Kind-Beziehung sind nicht voneinander zu trennen. Eine isolierte psychische Störung des Kindes gibt es in diesem Alter daher nicht. Die Beobachtung zeigt sehr klar: Je jünger die Kinder sind, umso schneller reagieren sie „ganzheitlich“, seelisch und somatisch, also körperlich, z. B. indem der Säugling nicht mehr isst, nicht mehr schläft, indem er Verstopfung hat o. a. Je älter das Kind wird, um so mehr treten isolierte psychische Probleme auf, ohne dass sich das im Körperlichen niederschlagen muss.
Wie sieht das neue Konzept der Tagesklinik für Kinder aus?
Gegen die Zunahme psychischer Krisen bei Kindern und Jugendlichen bieten wir deshalb ein ganzheitliches Therapiekonzept an, in dessen Rahmen wir Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in unserer Tagesklinik behandeln. Für einen Großteil der Schwierigkeiten in dieser Altersgruppe halten wir ein tagesklinisches Konzept für angemessen, weil die Kinder täglich in ihre Familien zurückkehren können, also nicht längerfristig von ihren Familien getrennt sind. Dadurch können wir auch mit der ganzen Familie wesentlich intensiver arbeiten als in einer ambulanten Therapie. Andererseits bleiben die Kinder und Jugendlichen im Gegensatz zur vollstationären Therapie in ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Letztlich ist es aber eine Frage des Schweregrads der psychischen Erkrankung, ob noch die Tagesklinik ausreichend ist oder ob vollstationär behandelt werden muss. Unsere Tagesklinik-Kinder werden alle in der Früh um 7.45 Uhr von ihren Eltern aus München oder dem Umfeld gebracht. Nach einem kurzen Ankommen gehen sie dann zunächst in die klinikinterne Staatliche Schule für Kranke, die wir hier im Haus haben. Dort haben sie bis 11.15 Uhr Schulunterricht in den wichtigsten Fächern. Die Schnittstelle Schule ist deshalb so enorm wichtig, weil viele Kinder eben schulbezogene psychische Probleme haben. Wir beobachten, wie die Kinder im Alltag Schule reagieren und wie man Verhaltensprobleme auch in der Schule verändern kann. Das ist ganz zentral im Rahmen unseres therapeutischen Konzeptes. Wir haben deshalb wöchentliche Besprechungen mit den Lehrern aus der Klinikschule, wo wir uns über die Entwicklung der Kinder austauschen. Dann kommen die Kinder aus der Schule auf die tagesklinische Station und haben über den Tag verteilt bis nachmittags unterschiedliche Therapien, einzeln und in der Gruppe: darunter sind gerade auch kreative Therapien wie Musik- und Bewegungstherapie. Dazu machen wir Unternehmungen in die Umgebung. Und wir haben auch Einzeltherapien, je nach Alter Spiel- oder Gesprächstherapie. Wir essen zusammen mit den Kindern zu Mittag. Der Alltag in der Gruppe, das soziale Miteinander der Kinder, ist ein ganz wichtiger Faktor der Therapie. Deshalb gibt es viele unterschiedliche Gruppentherapien. Zum das Beispiel das soziale Kompetenz-Training: Dort lernen die Kinder spielerisch sozial schwierige Situationen zu bewältigen. Zum Beispiel, wie sage ich jemandem meine Meinung oder etwas Kritisches, ohne ihn gleich zu verletzten, und ohne Gewalt. Oder: Wie grenze ich mich jemandem gegenüber ab, wenn ich von der Person nichts will, sie mir aber zu nahe kommt. Wie kann ich mich also abgrenzen und wie kann ich das klar meiner Umwelt signalisieren. In der Spieltherapie versuchen die Kinder, mit den Therapeuten über das gemeinsame Spiel mehr von ihren Problemen zu verstehen oder anders damit umzugehen. Ein ganz wichtiger Teil ist auch die Eltern- und Familienarbeit: Wir führen regelmäßige Gespräche mit den Eltern. Ich selber biete auch eine Elterngruppe an, wo die Eltern sich alle zwei Wochen mit anderen Eltern aus der Tagesklinik austauschen können. In unserer therapeutischen Arbeit nehmen wir teilweise auch konfliktreiche Situationen zwischen Eltern und Kind auf Video auf - natürlich nur mit ihrem Einverständnis. Zum Beispiel Hausaufgaben-Situation. Wir arbeiten dann direkt mit den Eltern am Video – sie sehen so ihr eigenes Verhalten und wir können mit ihnen überlegen: Was sind günstige Verhaltensweisen, was sind ungünstige und was können die Eltern verändern, damit alle gemeinsam solche schwierigen Situationen besser meistern – und solche Teufelskreise, in die man sich verrennt, kennen alle von Zuhause, die Kinder haben. Es geht also darum, solche Teufelskreise zu durchbrechen und einen Ausweg zu finden.
Wie entstehen Ängste und psychosomatische Erkrankungen?
Sie haben häufig etwas zu tun mit Ängsten, die es in der Familie gibt. Und sie haben häufig mit Entwicklungskrisen zu tun – wie bei Ophira. Zum Beispiel Kinder, die am Übergang in die Adoleszenz, also die Pubertät stehen. Sie können innerlich ein Dilemma entwickeln zwischen ihren Wünschen, größer, selbständiger und autonom zu werden. Salopp ausgedrückt: „Ich traue mich raus aus meinem Nest in die freie Welt.“ Auf der anderen Seite tauchen Sorgen auf, was einem alles passieren kann, wenn man allein auf sich gestellt ist, und sich in die weite Welt hinaus traut. In einer solchen Entwicklungskrise können gehäuft Ängste auftreten. Wenn sich eine Angststörung entwickelt, kann das dazu führen, dass die Kinder das Elternhaus gar nicht mehr verlassen. Die Angst – im Fall von Ophira, die Angst vor dem Verschlucken – bindet sie letztlich völlig an die Eltern. Das führt dazu, dass der Autonomieprozess komplett „eingefroren“ ist. Der Konflikt ist erst mal scheinbar verschwunden. Darin liegt zunächst einmal die entlastende Funktion des Symptoms. Da die Angst der Kinder so groß wird, dass sie das Elternhaus überhaupt nicht mehr verlassen können, wird dem Konflikt erst mal aus dem Weg gegangen. Aber der Preis ist sehr hoch und der Leidensdruck kann sehr schnell extrem groß werden. Deshalb ist es für Eltern, Freunde und Angehörige wichtig, Symptome wie z. B. Ängste sehr ernst zu nehmen, erst recht, wenn sie das Kind daran hindern, den normalen Alltagsaktivitäten nachzugehen. Wenn sie nicht mehr in die Schule gehen können, nicht mehr an Freizeitaktivitäten teilnehmen, dann sollte rasch Hilfe gesucht werden. Allerdings ist bei kindlichen Ängsten der Übergang von normalen in krankhafte Ängste besonders fließend. Ängste sind ein natürlicher Teil der Lebenserfahrung von jedem von uns. Ohne Ängste würde der eine oder andere von uns sich in lebensbedrohliche Kamikaze-Unternehmungen begeben. Die Frage ist also, ab wann sind solche Ängste pathologisch. Ophira kam in die Kinderklinik, als sie bereits etliche Kilogramm an Gewicht verloren hatte, weil sie nicht mehr essen konnte. Ein solches Ausmaß an Ängsten ist nicht mehr normal und intensiv behandlungsbedürftig.
Wie behandelt man solche Ängste?
Für die Therapie von Ängsten gibt es ein ganz klares System, das nennt sich Angstexposition. Das ist ein Prozess in vielen kleinen Schritten. Das bedeutet, dass mit dem Kind zusammen zunächst einmal eine so genannte Angst-Hierarchie aufgestellt wird: man klärt mit dem Kind ab, was sind die stärksten und was die geringsten Ängste, die es gibt. Immer bezogen auf das konkrete Symptom der psychischen Erkrankung. Bei Ophira also die Frage, was löst beim Essen die größte Angst aus, wenn sie sich vorstellt, etwas zu essen und was die geringste. Und danach fangen wir an, mit dem Kind zu üben, diejenige Situation beim Essen oder beim Verlassen der elterlichen Wohnung auszuhalten, die am wenigsten bedrohlich ist. Also die Situation, die auf der Angst-Hierarchie-Skala am niedrigsten ist. Und dann begleitet man die Kinder immer weiter: Die Kinder machen so die Erfahrung, dass das, was sie befürchten, nicht passiert. Ophira hat gemerkt: „Ich verschlucke mich ja gar nicht, wenn ich Joghurt esse.“ Dieses „Aha-Erlebnis“ ermöglicht es, dass die Kinder wieder Vertrauen und Selbstsicherheit gewinnen. Der nächste Schritt war also im Fall von Ophira, Joghurt mit ein bisschen Festerem drin anzubieten. Das Kind erlebt also im Rahmen der Angstexposition konkrete neue Erfahrungen und Erfolge, die ihm zeigen, dass die katastrophisierenden Befürchtungen, die bedrohlichen Angstphantasien ja gar nicht eintreten. So arbeiteten wir uns Stück für Stück in der Angsthierarchie weiter hoch bis dahin, dass Ophira wieder ganz normal essen konnte und das, was Angst auslöst oder ausgelöst hat, in der konkreten Situation wieder aushalten konnte. Das ist ein länger dauernder Prozess, in dem das Kind vor allem eine sehr enge Begleitung bekommt. Denn die Erfahrung, jemanden, der Sicherheit und Schutz vermittelt, in einer angstauslösenden Situation an der Seite zu haben und nicht allein zu sein, ist bindungstheoretisch etwas elementar Wichtiges. Genau da spielt die Beziehung eine große Rolle. Wir begleiten aber auch die Eltern sehr eng, weil ein Teil der Angst der Kinder noch durch die Reaktionsweise der Eltern verstärkt und potenziert wird. Beispiel: Wenn ein Kind vor einem Hund Angst hat, macht es einen riesigen Unterschied, ob Eltern das Kind beruhigen und ihm sagen: „Da passiert nichts, ich begleite dich, du bist nicht alleine. Du kannst da und daran erkennen, dass dieser Hund ganz lieb ist, er dir nichts Böses will.“ Wenn Mutter oder Vater selbst panisch reagieren, wenn dem Kind die stabile Bezugsperson durch eigene Angst wegbricht, dann potenziert das die Angst. Es lädt die Angst des Kindes noch um ein vielfaches auf. Das heißt: Je ruhiger und besonnener Eltern reagieren, wenn das Kind Angst zeigt, umso rascher kann das Kind die eigene Angst in den Griff bekommen. Elternbegleitung ist also bei psychischen Symptomen etwas ganz zentrales.
Wo liegen die Ursachen dieser Symptome?
Neben der verhaltenstherapeutischen Therapie in der konkreten Situation arbeiten wir in erster Linie tiefenpsychologisch. Wir versuchen also insbesondere auch, die tiefer liegenden Konflikte, die hinter solchen Ängsten liegen, zu bearbeiten. Man muss also einerseits die Angst unter Kontrolle bekommen und auf der anderen Seite mit der ganzen Familie klären, was eigentlich die tiefer liegenden Konflikte sind, die solchen Ängsten zugrunde liegen und wie sie sich lösen lassen. Hier Licht ins Dunkle zu bringen, ist natürlich mitunter ein sehr schwieriger Prozess. Denn oft sind die Angststörungen, unter denen Kinder leiden, vermittelte Ängste, denen familiäre Ängste oder Konflikte zugrunde liegen können: Wenn Kinder extreme Trennungsängste entwickeln, kann es zum Beispiel sein, dass Eltern selbst traumatische Verluste erlebt haben, wo Angehörige oder ein Geschwisterkind lebensbedrohlich krank waren oder gestorben sind. Wo Eltern vor diesem Hintergrund dann bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit des Kindes unrealistische Phantasien und Befürchtungen haben, was dem Kind alles zustoßen oder passieren könnte. Wenn sich solche elterlichen Ängste auf das Kind übertragen und das Kind somit die Außenwelt primär als bedrohlich und gefährlich erlebt, dann wird es auch nicht das Vertrauen entwickeln, sich neugierig und vertrauensvoll in diese Außenwelt hineinbegeben und diese erkunden zu können. Im Vordergrund steht dann die Angst nach dem Motto: Vorsicht, was kann mir da alles passieren. Oder was kann den Eltern alles passieren, wenn ich mich weg begebe, wenn ich nicht Zuhause bin und die Kontrolle habe, dass alles in Ordnung ist. Dann entstehen solche Phantasien.
Haben Sie Schwerpunkte in Ihrer Tagesklinik?
Neben den Ängsten und Depressionen ist einer unserer Schwerpunkte die Behandlung von Essstörungen, die nicht unter die Definition einer klassischen Magersucht fallen. Es gibt durchaus vielfältige Essstörungen in dieser Altersgruppe, über die es jedoch noch sehr wenig Wissen gibt, wie sie entstehen. Wir haben durch unsere langjährige Erfahrung auf der Eltern-Kleinkind-Station festgestellt, dass viele Essstörungen im Grundschulalter eigentlich verschleppte Probleme aus dem frühen Säuglings- und Kleinkindalter sind. Diese Kenntnisse aus unserer langjährigen Erfahrung helfen uns sehr, die unterschiedlichen Essprobleme im Grundschulalter besser zu verstehen und dafür Behandlungskonzepte zu entwickeln. Kinder mit einer früh beginnenden typischen Magersucht behandeln wir allerdings in der Tagesklinik nicht, da die Erfahrungen zeigen, dass hier, wenn eine ambulante Psychotherapie nicht ausreichend ist, nur eine vollstationäre Therapie, in der das Essen quasi rund um die Uhr begleitet wird, erfolgversprechend ist. Es ist ganz wichtig, dass Eltern und besonders Mütter bei Problemen mit ihren Kindern nicht die Schuld bei sich suchen und das Problem tabuisieren, sondern darüber sprechen und sich Hilfe suchen. Man kann je früher, desto besser vorbeugen, damit sich später keine schwierigen Verläufe entwickeln. Aus Mangel an Kenntnissen über die Vielfalt der Erscheinungsformen von Essstörungen im Grundschulalter bekommen aber vor allem junge Mädchen ganz schnell den Stempel aufgedrückt, magersüchtig zu sein. Wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass es sich darum überhaupt nicht handelt. Bei Ophira hat sich die Angst zum Beispiel zu einer Form der Essstörung entwickelt, die keinerlei Symptome einer Magersucht aufwies.
Welche Rolle übernehmen kranke Kinder im System von Familien?
Kinder, die psychisch krank werden, übernehmen bei tiefer liegenden Konflikten in Familien häufig eine „Mediums-Funktion“: Wir stellen immer wieder fest, weil wir ja das ganze ‚System Familie' behandeln, dass Probleme durchaus an einzelne Kinder delegiert werden. Sie übernehmen dann die Entlastungsfunktion, die die Familie braucht, um nicht völlig aus der Balance zu geraten. Und es kann für die ganze Familie in der Tat manchmal etwas enorm Entlastendes haben, wenn ein Kind ein Symptom entwickelt. Alles fokussiert sich dann auf dieses Symptom, und die Energie und Aufmerksamkeit wird weggelenkt von einem sehr viel wichtigeren anderen Konfliktbereich, z. B. einem latenten elterlichen Trennungskonflikt. Das kann für die gesamte Familie entlastend sein.
Aber doch nur solange das Kind nicht total zusammenbricht und nicht mehr funktioniert? Können solche Kinder ein Familiensystem durch ihre Krankheit auch sprengen, damit es verändert werden muss?
Ja, aber wenn man dann nur das Symptom behandelt und beseitigt und nicht im Auge hat, welche entlastende Funktion es ursprünglich hatte, braucht das System weiter Entlastung. Wenn man die Funktion des Symptoms also auf der Familienebene nicht verstanden hat, dann wird entweder dasselbe Kind oder ein anderes Kind früher oder später wieder ein Symptom entwickeln, weil das System die Entlastung des Symptoms braucht. Deshalb ist es so wichtig, mit den Familien als Ganzes zu arbeiten, nicht nur symptomfokussiert Beschwerden zu beseitigen, sondern die Dynamik zu verstehen, unter der sich solche Beschwerden entwickeln, und zu verstehen: welche Funktion hat die Erkrankung des Kindes für die Eltern und die Familie - zum Beispiel zu begreifen, warum genau dieses Kind jetzt gerade mit Essproblemen reagiert.
Wo beginnt die Krankheit?
Trotz einer immer stärker wachsenden Zahl von Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen, entwickeln sich auch unter widrigen Bedingungen immer noch mindestens zwei Drittel aller Kinder hinreichend gesund, das ist doch bemerkenswert! Das ist die gute Nachricht. Die sog. Resilienzforschung – also jene Forschung, die untersucht, was uns psychisch widerstandsfähig macht – zeigt, dass wir Menschen uns auch unter widrigen Bedingungen im großen und ganzen recht gut behaupten können. Dass es Probleme und Belastungen gibt, ist also nichts Besonderes. Jede Familie hat unterschiedliche Belastungen durchzustehen. Wir wissen auch, dass Belastungen in kleinerem Ausmaß sogar die Fähigkeit des Individuums, sich selbst zu regulieren und zu stabilisieren, fördern können. In gewissen Grenzen haben Belastungen also auch eine entwicklungsfördernde Funktion. Aber immer nur dann, wenn es noch genug Unterstützung und Ressourcen gibt. Und vor allem, wenn es gesunde und gute Beziehungen gibt für die Kinder, die ihnen helfen, diese Belastungen aufzufangen.
Damit haben sie doch einen echten Teufelskreis beschrieben: Man weiß aus der modernen Entwicklungs-Forschung also sehr genau, was Kinder eigentlich brauchen, was sie stabil und psychisch widerstandsfähig bei Belastungen, Problemen und Krisen macht. Aber offensichtlich sind genau diese Aspekte und Faktoren des spielerischen und kreativen Lernens in einer sich ständig beschleunigenden Leistungsgesellschaft immer mehr unterbelichtet.
Diesen Teufelskreis muss man im Auge haben, um die Widerstandsfähigkeit der Kinder und der Familien zu stärken. Heute haben in der Schule und im Alltag unserer Kinder zunehmend die spielerischen und kreativen Aspekte, die uns psychisch stabil machen, keinen Platz mehr. Es ist deshalb wichtig, dass sich unsere Gesellschaft über diese fatale Entwicklung und die Folgen des sich ständig beschleunigenden Leistungsdruckes bewusst wird.
Michael Backmund
- Themen: