Werktreu und doch mehr: „Der Fremde“ als Film von François Ozon
„Heute ist Mama gestorben. Oder vielleicht gestern, ich weiß es nicht.“ So beginnt Albert Camus’ Bestseller von 1942 - und legt damit sofort eine Eigenschaft der Hauptfigur offen: eine Gleichgültigkeit, die - im Laufe der Geschichte gesteigert - klare Empathielosigkeit ist. Bei Meursault, einem jungen, schönen, talentierten, aber für einen Mr. Ripley zu passivem Typ, wird das tiefgreifende Gefühl klar, dass er sich in der Welt „fremd“ fühlt, was ihn nicht hindert, seine Umgebung analytisch wahrzunehmen.

„Liebst du mich?“: „Das ist nicht wichtig.“
Regisseur François Ozon übernimmt in seinem glänzend intensiven Schwarz-Weiß-Film „Der Fremde“ diesen Blick - auch auf Algerien als französische Kolonie. „Ich habe einen Araber getötet“ - ist der zweite Schlüsselsatz des Buches. Meursault (Benjamin Voisin) sagt ihn auf die fragenden Blicke seiner arabischen Mitgefangenen, als er vorübergehend als einziger Weißer mit ihnen in eine Gruppenzelle gesperrt wird. Dann erzählt der Film die Tage davor: von der Beerdigung der Mutter über eine Liaison mit einer schönen Frau (Rebecca Marder). „Liebst du mich?“ fragt sie ihn nach einer gewissen Zeit, man war schon Schwimmen, im Kino und im Bett: „Das ist nicht wichtig“, sagt er und setzt die Beziehung ungerührt fort. Wie ihm auch die Zuhälterei seines Wohnungsnachbarn egal ist, er sie sogar vor der Polizei deckt. Und der misshandelte Hund des alten Mannes von oben tut ihm auch nicht leid. So geht es bis zum tödlichen Schuss auf einen jungen Araber - am Strand in gleißender Sonne, deren Wirkung er zur Irritation des Gerichts und der Öffentlichkeit als einziges Tatmotiv nennt.
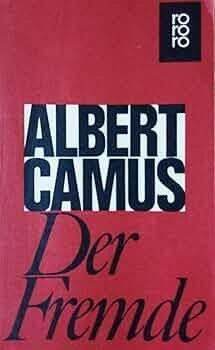
Wie kann man sich subtil vom Kolonialismus abgrenzen?
Wie Camus’ Original setzt Ozon den Film in die 30er Jahre und distanziert sich subtil von der französischen Fremdherrschaft in Algier, indem die Kamera über Mauern fährt, auf denen schon Befreiungsparolen geschmiert sind, und in Cafés herrscht sichtbar „Rassentrennung“. Ozon empört sich in seinem Film nicht auffällig darüber, lässt auch wie im Buch „die Araber“ anonym, während Europäer individualisiert sind. Aber das ist nur konsequent, weil auch Camus’ Erzählung der Sicht Meursaults folgt. Und dann sind es die vielen kleinen Einsprengsel, die eben doch das Bild zurechtrücken - wie die abgeschnittene Nase einer Frau, die als Prostituierte gearbeitet hat oder den anfänglichen Versuch der Justiz, den Europäer vor der Todesstrafe zu schützen, die fast nur bei Arabern angewendet wird.

Camus verwendet im Roman viel Raum mit dem Prozess und mit dem Versuch eines Priesters, dem Mörder in der Zelle, noch Gott nahezubringen. Am Ende wird klar: Damit ein distanzierter, fatalistischer Nihilismus nicht ins Unmenschliche und puren Zynismus kippt, braucht es einen humanistischen Untergrund. Den kann das Christentum für viele zwar nicht mehr glaubwürdig liefern, aber vielleicht ein moralisch grundierter, moderner Existenzialismus.
K: Arena, Maxim, Leopold Solln sowie City, Isabella, Theatiner (auch OmU) R: François Ozon (F, 122 Min.)







