Episodisch verdichtet und mit außergewöhnlichen Charakteren: "Wachs" von Münchner Autorin nominiert für Deutschen Buchpreis

Audio von Carbonatix
"Von Frauenhand gezeichnet bedeutet im Auge der Welt, dass es a) hübsch ist und b) vermutlich falsch. Es ist dies nicht gerecht und durch keine Beweise gedeckt", schreibt Madeleine Basseporte 1745 an den Naturforscher Carl von Linné. Und das klingt auch 280 Jahre später längst nicht so irreal, wie es sein sollte.
Jetzt widmet die Münchner Schriftstellerin Christine Wunnicke der französischen Malerin und Kupferstecherin Madeleine de Basseporte (1701–1780) sowie deren Schülerin Marie de Biheron (1719–95) ihr schmales, inhaltlich opulentes Buch "Wachs". Darin skizziert sie die Leben zweier außergewöhnlicher, eigensinniger Charaktere. Episodisch verdichtet und in einigen Zeitsprüngen, und dabei mit keinem Wort zu wenig und keinem zu viel. Und wie oft bei Wunnicke dreht sich der Roman um historische Persönlichkeiten. Die zart getuschte Liebesgeschichte der beiden Ausnahme-Frauen allerdings ist Interpretation.
Das Hintergrundrauschen bieten die letzten Jahre des Ancien Régime, die in die Revolution münden, und die ersten der Ersten Republik. Das sogenannte Zeitalter der Vernunft also, in dem Wissen an die Stelle des Glaubens rückt – oder auch nur der Glaube, Recht zu haben.
Buch "Wachs" für Deutschen Buchpreis nominiert": Die Welt als moribundes Tollhaus
Ungeheure Wissbegier jedenfalls treibt Marie an. Als ihr Vater stirbt, denkt sie vor dessen Leichnam: "Ich mache die dicke Haut ab, finde darunter die Feder, und ziehe sie neu auf, damit er wieder tickt." Bereits als 14-Jährige schneidet die Apothekertochter, die nach der erneuten Heirat der Mutter sich selbst überlassen ist, ihre erste Leiche auf: "Es zeigt die Wahrheit. Was innen liegt. Ich will Gottes vornehmste Schöpfung verstehen." Dass es sich dabei wirklich um letztere handelt, daran nähren sich später auch bei der Protagonistin starke Zweifel.

Wunnicke zeichnet eine zusammenbrechende Welt als moribundes Tollhaus voller potenzieller Leichen, in dem sich Menschen wie Tiere benehmen – und Tiere menschlich erscheinen. Doch es entsteht das Momentum von Freiheit: Die sanfte, disziplinierte Madeleine und die energische, beharrliche Marie gehen ihres Wegs, der wundersamerweise immer weiter in die Höhen der Künste, der Erkenntnis und – im Rahmen dessen, was Frauen möglich war – zu Anerkennung und finanzieller Unabhängigkeit führt.
Amüsante Dialoge mit Diderot
Beide arbeiten auf ihre Weise an der möglichst exakten Darstellung von Wirklichkeit. Während Madeleine für diverse Auftraggeber botanische Illustrationen anfertigt, Zeichenunterricht gibt und als Pflanzenmalerin im Jardin du Roi angestellt ist, erschließt sich Marie eine lukrative Einkommensquelle als Schöpferin detailgenauer anatomischer Wachsmodelle, mit inneren Organen zum Auseinandernehmen. Damit wird sie europaweit berühmt, sogar Katharina die Große ließ sich Biherons Werke nach Russland liefern.
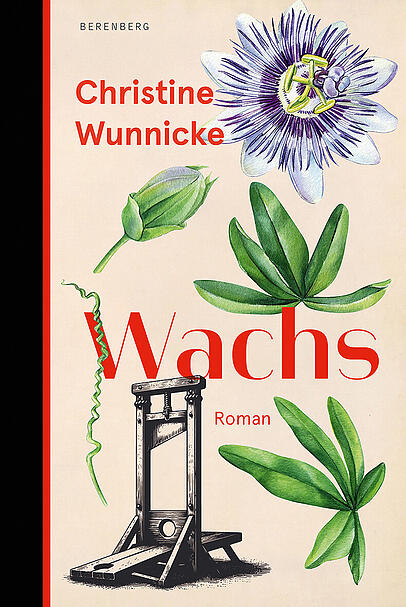
Auch Denis Diderot lernt bei ihr über die Anatomie. Die Dialoge mit ihm gehören zu den amüsantesten Passagen, weil diese Marie natürlich nicht auf den Mund gefallen ist und ihm ständig widerspricht. "Vom Irrtum" schlägt sie ihm vor, solle man seine und d’Alemberts stolze Enzyklopädie doch besser nennen. Den zerstreuten Gelehrten karikiert sie als ein großes Kind, das seinen Flausen folgt, während seine resolute Frau ihn die harte Realität zurückholt.
Christine Wunnicke gießt "Wachs" mit feinem Humor aus, der Band ist durchwirkt von Esprit-blitzenden Wortgefechten und unsentimentalen Betrachtungen über die Hinfälligkeit der Körper.
Für ihr literarisches Gesamtwerk bekommt die Schriftstellerin nun auch den diesjährigen, mit 20.000 Euro dotierten Jean-Paul-Preis. "Ihre Kunst der historischen Momentaufnahme, die sie zum kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Bild aufspannt, besteht in einer ebenso eleganten wie klaren Textökonomie: Ihre Erzählungen sind stets in eine Spannung aus Verknappung und verblüffendem Detail gesetzt", heißt es in der Begründung der Jury.
In Wunnickes Imagination fürchtet sich schließlich der große Diderot nur vor einem in Maries Studio, vor dem "schlimmen Sack": Damit meint er die "Coudray’sche Maschine", das Modell des Rumpfes einer Gebärenden mit Kind, anhand derer Hebammen zur Schulung den Geburtsvorgang nachstellen. Mag der Geist auch noch so aufgeklärt sein, der blutige Ursprung der Welt lehrt den armen Mann das Fürchten.
Christine Wunnicke: „Wachs“ (Berenberg, 185 Seiten, 24 Euro).
- Themen:
- Kultur





