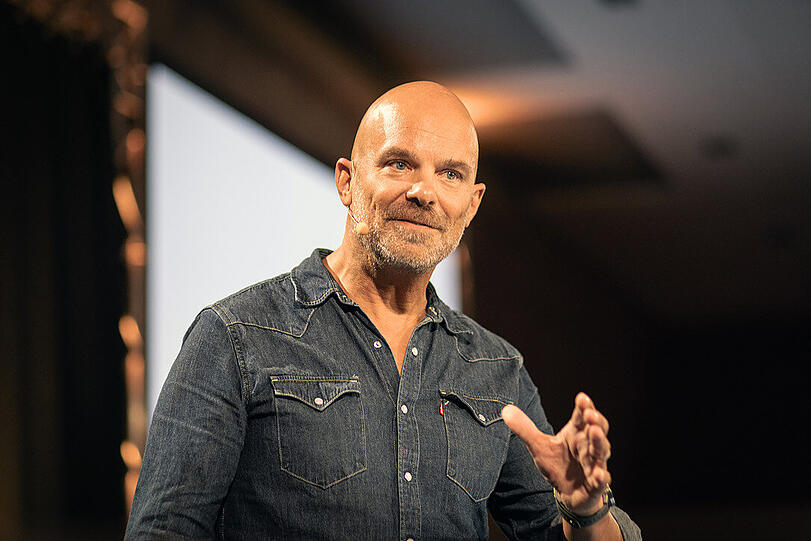"Nicht geschimpft ist gelobt genug": Fatale Fehler von Chefs
Wenn Mitarbeitende im Job nicht motiviert sind, kann das am Chef liegen. Wie positive Führung funktioniert und was man selbst tun kann, erklärt Christian Thiele im AZ-Interview. Der Coach kommt aus Garmisch-Partenkirchen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema.
AZ: Herr Thiele, was denken Sie: Wie steht es um die Motivation bei Mitarbeitern in deutschen Unternehmen?
Christian Thiele: Es gibt aktuelle Studien, unter anderem die Gallup-Engagement-Studie. Demnach sind 13 Prozent der deutschen Beschäftigten emotional überhaupt nicht engagiert. Man spricht hier auch von innerer Kündigung. Rund zwei Drittel machen Dienst nach Vorschrift. Gerade mal neun Prozent gelten als hochmotiviert. Sie brennen für die Sache. Das ist im Durchschnitt jeder Zehnte oder jede Zehnte. Eine Studie von EY hat ergeben, dass 48 Prozent der deutschen Angestellten ihr Bestes in der Arbeit tun. Damit liegt der Wert in Deutschland vergleichsweise niedrig.
Woran liegt es?
Das soziale Verhältnis zur Führungskraft ist eines der wichtigsten überhaupt. Es ist zwar schön, wenn man ein tolles Büro und vielfältige Aufgaben hat. Auch das Gehalt ist nicht unwichtig. Aber die meisten Menschen gehen, weil sie sich von ihrer Führungskraft zu wenig gesehen, gewertschätzt und respektiert fühlen. Das ist ein zentraler Hebel für Motivation und Zufriedenheit in der Arbeit.
Es wird immer wichtiger, gutes Personal zu begeistern
Was machen Chefs aus Ihrer Sicht am häufigsten falsch? Loben Sie zum Beispiel zu wenig?
Ich kenne wenige Leute, die sagen: „Ich halte das ständige Loben und die Dankbarkeit meiner Führungskraft nicht mehr aus.“ (lacht) Die meisten Führungskräfte überschätzen, wie viel Anerkennung und Lob bei ihren Mitarbeitenden ankommt. „Nicht geschimpft ist gelobt genug“ stimmt eben nicht.
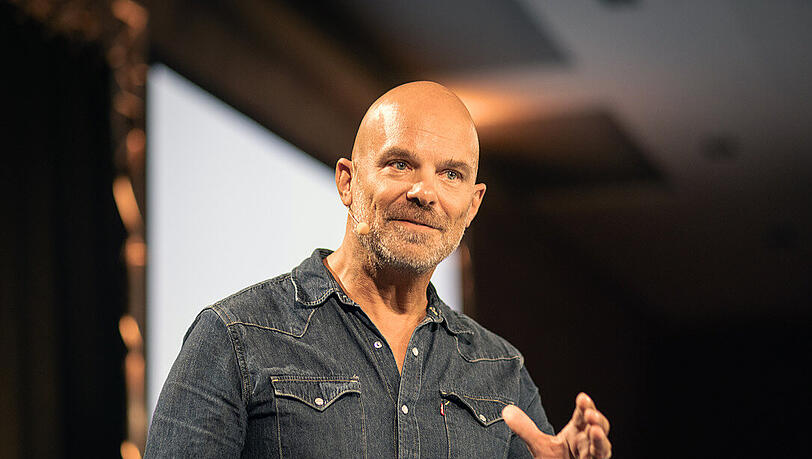
Der in Bayern gern angeführte Spruch ist also nicht mehr zeitgemäß?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil: Wertschätzung schafft Wertschöpfung. Und: Nur jeder beziehungsweise jede Fünfte sagt aktuell, sie oder er traue der eigenen Führungskraft - 2019 gab das noch die Hälfte der Befragten an. Auch wenn die konjunkturelle Situation es gerade etwas überdeckt, aber wir haben einen strukturellen Mangel an Arbeitskräften auf allen Ebenen. Es wird also eine strategisch immer wichtigere Ressource, dass Führungskräfte in der Lage sind, gute Leute zu finden, zu binden, zu motivieren und zu begeistern. Ein patriarchalischer Stil von oben nach unten gemäß dem Motto „Ich schaffe an, du führst aus“ wird tendenziell höhere Krankenstände mit sich bringen, ebenso höhere Wechselraten, weniger Zufriedenheit im Team sowie auch weniger Kundenzufriedenheit und -umsätze.
Die fünf Säulen für motivierte Mitarbeiter
Was macht einen guten Chef im Jahr 2025 aus Ihrer Sicht aus?
Ich richte das sehr stark am Modell der positiven Führung mit fünf Säulen aus. Diese führen dazu, das Wohlbefinden und das Engagement zu steigern und zugleich die Stressbelastung, die Burnout-Symptomatik und Fluktuation zu reduzieren.

Welche fünf Säulen sind das?
Die Abkürzung ist P-E-R-M-A. P steht für positive Emotionen. Inwiefern sorgt die Führungskraft dafür, dass Zuversicht, Klarheit, Hoffnung und Freude entstehen? Das E steht für Engagement: Inwiefern kennt der Chef die Stärken der Mitarbeiter? Weiß er und ermöglicht er, dass sie einen Beitrag zum Erfolg leisten? Das R, die dritte Facette, steht für das englische Wort Relationship. Es geht um ein Wir-Gefühl, eine Team-Identität. Gerade bei Teams, in denen remote gearbeitet wird, ist es wichtig, dass sich Leute nicht isoliert führen. Das vierte Rezept für positive Führung heißt Meaning. Schafft es der Vorgesetzte, dass Mitarbeiter, gerade bei Routine-Arbeiten, spüren, wofür sie es machen? Es geht also nicht nur darum, auf das Wann und Wie einer Aufgabe zu schauen, sondern auch auf das Wozu.
Und die letzte Säule?
Die fünfte Säule - A - steht für Accomplishment oder Applaus. Sprich: Nicht nur auf die To-Dos achten, sondern auch auf die Tadaaas: Das Team, aber auch Einzelne sollten spüren, dass sie etwas geschafft haben, statt immer nur Aufgaben, Terminen und To-Do-Listen hinterherzuhechten.
"Davon verabschieden, als Chef der beste Kumpel im Team zu sein"
Was macht man als Arbeitnehmer, wenn der eigene Vorgesetzte diese Dinge nicht beherzigt? Wie spricht man es an?
Man darf Wünsche äußern, zum Beispiel so: „Das gefällt mir gut, wie du mich führst, und an dieser Stelle würde ich mir mehr oder anderes wünschen."

Welche Eigenschaften braucht ein Chef?
Eine gewisse Sympathie für Menschen ist wichtig, gleichzeitig aber auch, Entscheidungen treffen zu können, die dem ein oder anderen auch wehtun könnten. Man muss sich davon verabschieden, als Chef die Freundin oder der beste Kumpel im Team zu sein.
Sind Ältere wirklich mehr motiviert als die Gen Z?
Der EY-Studie zufolge variiert die Motivation zwischen Baby-Boomern und Gen Z. Die Älteren sind demnach motivierter. Wie erklären Sie sich das?
Ehrlicherweise bin ich etwas skeptisch, was die Unterschiede bei den Generationen betrifft. Denn das Generationen-Konzept vereinfacht unser Denken, in der Realität ist es häufig nur sehr bedingt zutreffend.
Generell hat sich in den vergangenen Jahren ein Wechsel vollzogen, welche Erwartungen an gute Arbeit gestellt werden. Etwa flexibler sein und im Homeoffice arbeiten zu können. Das äußern nicht nur die Generationen Y und Z, sondern das zieht sich quer durch alle Altersgruppen.
Wie kann man als Arbeitnehmer seine eigene Motivation erhöhen, wenn die Rahmenbedingungen erst mal bestehen bleiben?
Unsere Tätigkeit wird oft wie eine Art Betonform verstanden, in die man reinpassen muss. Ich würde es günstiger finden, wenn wir unsere Jobs wie aus Gummi oder Wachs betrachten. Man kann also etwas verändern und sich überlegen: Was sind die Tätigkeiten, die mir Kraft und Energie geben und in die ich meine Stärken einbringen kann? Kann ich davon vielleicht mehr machen? Und dafür andere Aufgaben, die mir den Stecker ziehen, abgeben?
Kleine Tricks und Tipps für mehr Motivation
Ganz akut: ein unmotivierter Tag. Was hilft?
Was in den 80ern und 90ern stark propagiert wurde, war die „Eat-the-Frog“-Theorie. Also die schwerste Aufgabe des Tages gleich zu Beginn runterschlucken wie einen Frosch. Aus Sicht der Motivations-Forschung kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Ich würde zunächst eher ein kleines Erfolgserlebnis wählen. Eine Mail, eine Anfrage, die mir mit wenig Aufwand ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Erfolg verschafft. Das Zweite: Was sind an diesem Tag Dinge, bei denen ich meine Stärken einbringen kann? Vielleicht kann man sich auch eine Belohnung von vornherein vornehmen, etwa ein Eis am Abend. Gerade bei Routine-Aufgaben sollte man sich - viertens - vergegenwärtigen, was andere davon haben, wenn ich die Tätigkeit tue. Im Umkehrschluss: Welche Folgen hätte es, wenn ich sie nicht tue? Das hilft mir persönlich, Dinge über den Berg zu rollen, die ich nicht so liebe.
- Themen: