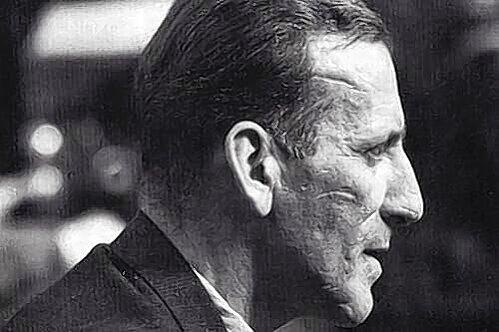AZ-Serie: Vor Gericht beteuerten alle Nazi-Verbrecher ihre Unschuld
Hermann Göring war der ranghöchste Angeklagte. Vor der Hinrichtung brachte er sich mit einer Giftampulle um.
NÜRNBERG Adolf Hitler, den größenwahnsinnigen Führer, Joseph Goebbels, seinen gnadenlosen Einpeitscher, und SS-Chef Heinrich Himmler, den Drahtzieher des Holocaust, kannte jeder. Sie waren die exponiertesten Repräsentanten des verbrecherischen Dritten Reichs. Auf der Anklagebank der Nürnberger Prozesse fehlten sie. Alle drei hatten im kollabierten „1000-jährigen Reich“ Selbstmord begangen. Trotzdem war es schon mehr als nur die zweite Garnitur der Staatsmacht, die vom Internationalen Militärgerichtshof zur Rechenschaft gezogen wurde.
Die Persönlichkeitsprofile der 24 angeklagten Hauptkriegsverbrecher, die am 20. November 1945 in den mittlerweile zur Berühmtheit gelangten Sitzungssaal 600 des Nürnberger Justizgebäudes gebracht wurden, könnten nicht unterschiedlicher sein. Sie reichen vom primitiv geifernden Judenhasser Julius Streicher bis hin zum kühl kalkulierenden, am Schreibtisch mordenden Ernst Kaltenbrunner (Chef des Reichssicherheitshauptamtes), vom smarten Rüstungsminister Albert Speer bis hin zum durchgeknallten Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. Was alle Angeklagten trotz ihrer Unterschiede im Prozess verband: Sie fühlten sich nicht schuldig.
Reichsfeldmarschall Hermann Göring, von Morphiumsucht geplagter Chef der Luftwaffe, war der ranghöchste Offizier der Hitlerschen Wehrmacht. Deswegen allein saß er aber nicht auf der Anklagebank. Göring, der in Fürth und Ansbach zur Schule ging, und eine Zeitlang mit seinen Eltern die Burg Veldenstein in der Fränkischen Schweiz bewohnte, war eine der maßgeblichen Persönlichkeiten im braunen Sumpf. Er rief die Geheime Staatspolizei (Gestapo) ins Leben, gründete die ersten Konzentrationslager und betrieb die Aufrüstung zum Krieg. 1941 beauftragte er den Chef des Reichsicherheitshauptamtes mit der „Endlösung der Judenfrage“. Dass er zum Tod verurteilt wurde, war nicht überraschend. Die geplante Hinrichtung ersparte er sich. Wenige Stunden vorher schluckte er Gift. Ein Wachsoldat spielte es ihm zu.
Erstmals in der Geschichte mussten sich bei den Nürnberger Prozessen Staatsmänner und verantwortliche Amtsträger für einen angezettelten Krieg verantworten. Dass sich darunter auch hochrangigste Militärs (Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der Marine, Hitlers Militär-Berater Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht) befanden, die sich lediglich als verlängerter Arm bei der Durchsetzung des politischen Willens verstanden, stößt in konservativen Kreisen mitunter heute noch auf Kritik. Verantworten mussten sich die Hauptkriegsverbrecher in vier Punkten: Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen und Verstöße gegen das Kriegsrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Angeklagt war auch Martin Bormann, eine unheimliche Gestalt im Machtgefüge der Nazis. Er war Chef der Reichskanzlei, Hitlers engster Mitarbeiter. Wer den Führer sehen oder sprechen wollte, kam an ihm nicht vorbei. Allein das verlieh ihm ungeheuere Macht. In Südamerika zeigen noch heute Einheimische auf ein zerfallenes Haus, in dem Martin Bormann nach dem Krieg gelebt haben soll. Ein Märchen, wie man erst seit relativ kurzer Zeit weiß. Knochen, die in Berlin bei Aushubarbeiten gefunden wurden, belegen, dass er am Ende des Krieges bei einem Fliegerangriff starb. Das Tribunal in Nürnberg verurteilte ihn in Abwesenheit zum Tode.
Wie der ideale Soldat für ihn aussah, beschrieb Hitler so: schnell wie ein Windhund, zäh wie Leder, hart wie Krupp-Stahl. Gustav Krupp (von Bohlen und Halbach), Chef des gleichnamigen Stahlkonzerns aus dem Ruhrgebiet, bezahlte seine Nähe zu den Mächtigen des Nazi-Regimes mit einer Anklage als Hauptkriegsverbrecher. Dem Repräsentanten der Schwer- und Rüstungsindustrie wurde vorgeworfen, an der Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskrieges beteiligt gewesen zu sein. Wegen seiner unfallbedingten Verhandlungsunfähigkeit wurde das Verfahren gegen ihn aber eingestellt.
In einem der zwölf Nachfolgeprozesse, die in Nürnberg stattfanden, waren noch einmal 185 Personen angeklagt: Ärzte, Mitglieder von SS und Polizei, Industrielle und Manager, militärische Führer, Minister und Regierungsvertreter. Diese Verfahren dauerten bis 1949. Helmut Reister
- Themen:
- Polizei