Raubkunst in Münchner Museum: So viele Kunstwerke sind dringend verdächtig

Transparenz ist gefordert. Das betrifft nicht nur den heftig kritisierten Umgang des Freistaats und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit der NS-Raubkunst, sondern genauso die unhaltbaren Zustände an den Pinakotheken. Nach der Aufdeckung der Missstände im Frühjahr kündigte Kunstminister Markus Blume (CSU) die "schonungslose" Aufklärung an. Gestern hat er nun die Ergebnisse im Kulturausschuss des Bayerischen Landtags vorgestellt.
Raubkunst: 82 Kunstwerke sind dringend verdächtig
Von den mehr als 200 Kunstwerken, die auf einer veralteten internen Liste als dringend raubkunstverdächtig markiert waren, fallen noch 82 Werke in diese "rote" Kategorie. Hinzu kommen zahlreiche weitere Objekte, bei denen die Herkunft zweifelhaft sei. Das ergaben die jüngsten Überprüfungen unter der Leitung der Provenienzforscherin Meike Hopp, die dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste vorsteht.
Hopp bemängelte, dass es neben der fehlenden Transparenz auch kein organisatorisch systematisches Vorgehen bei den Recherchen gab. Das hätte etwa dazu geführt, dass zentrale Werkkomplexe bisher nicht zufriedenstellend bearbeitet wurden. Betroffen seien davon insbesondere "rund 3000 Objekte, die nach 1945 erworben oder inventarisiert wurden".
Mehr Personal für die Provenienzforschung
Das soll nun alles offensiv angegangen werden – nicht zuletzt mit mehr Personal im Bereich der Provenienzforschung, die in die zum Juli gegründete Museumsagentur eingegliedert ist und nicht mehr den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen untersteht.
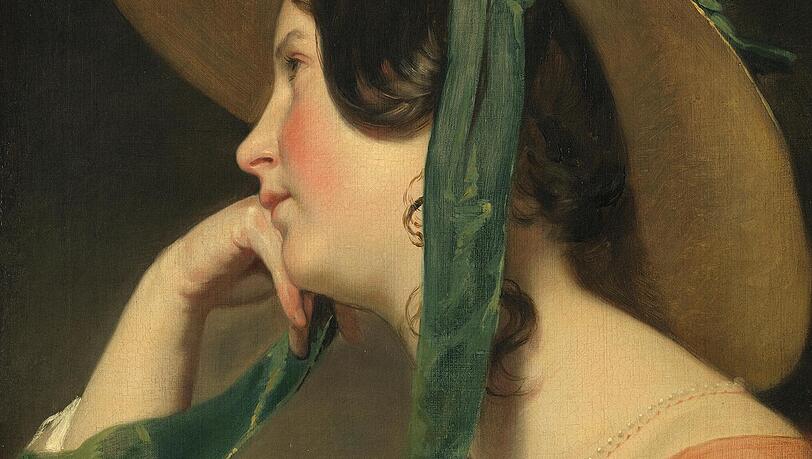
Auch für die Besucher selbst wird es künftig mehr Klarheit gegeben: In den Schausälen der Pinakotheken soll ein Ampelsystem mit QR-Codes über die Herkunft der Werke informieren – sofern sie fragwürdig seien. Das kündigte Anton Biebl, seit April Chef der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, an. Ursprünglich als Change-Manager für die bayerische Museumsoffensive engagiert, ist der ehemalige Kulturreferent der Stadt München vor allem damit beschäftigt, die Malaisen in den Pinakotheken zu beseitigen.
Sexuelle Belästigung gab es
Es gab Vorwürfe sexueller Belästigung von Besucherinnen durch das Sicherheitspersonal, die sich bestätigt haben, erklärte Minister Blume. Die betreffenden Mitarbeiter gehörten zu einer Fremdfirma und seien nicht mehr für die Staatsgemäldesammlungen tätig. Dass Mitarbeiter bespitzelt wurden, ließ sich nicht mehr aufklären. Die erheblichen Mängel bei der Sicherung der Kunst, von denen berichtet wurden, hatten sich dagegen als haltlos erwiesen.

Auch Biebl setzt auf Transparenz und eine neue Gesprächskultur, überhaupt mehr Kommunikation – auch mit dem Aufsichts- und dem Sicherheitspersonal. Dass bis Ende 2026 fünf von zehn Sammlungsleitern das Haus verlassen haben, begreift er als Chance, nicht nur "die Alte Pinakothek neu zu denken". Es ist auch nicht geplant, diese Stellen (in absehbarer Zeit) wieder zu besetzen.
Hat die Sammlungspflege ausgedient?
Das klingt nach einer grundlegenden Umstrukturierung in den staatlichen Museen. Was dabei lässig übergangen wird, ist die Kompetenz, die mit diesen gut vernetzten Fachleuten verloren geht. Ausstellungen können freilich von externen Kunstexperten kuratiert werden, das ist ein übliches Prozedere. Doch wer fest an einem Museum für eine Sammlung zuständig ist, pflegt intensive Kontakte zu Sammlern, Mäzenen und Stiftungen. Die allerdings schätzen verlässliche Ansprechpartner.

